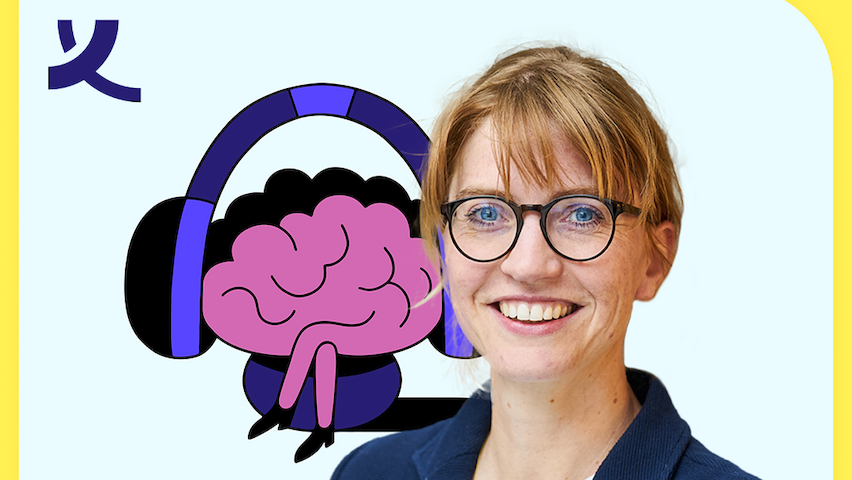Werner Plumpe: Die Kraft des Kapitalismus.
Geschichte ist Gegenwart! Der History & Politics Podcast der Körber-Stiftung
Über den Umgang mit Wirtschaftskrisen im 20. Jahrhundert und heute
Am 24. Oktober 1929 begann mit dem Börsensturz in New York die große Weltwirtschaftskrise, mit einschneidenden sozialen und politischen Folgen. Der Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe erläutert im Podcast, welche Lehren aus 1929 gezogen wurden und wie sich der Kapitalismus im 20. Jahrhundert entwickelte und weltweit durchsetzte – insbesondere nach dem Zusammenbruch des Kommunismus 1989. Er zeichnet nach, wie es zur Weltfinanzkrise 2008 kommen konnte und gibt eine Antwort auf die Frage nach der Zukunftsfähigkeit des Kapitalismus angesichts von Klimakrise und knapper werdenden Ressourcen.
Heiner Wember: Was dem Kapitalismus noch nie fehlte, sind Feinde. Die einen machten den Manchester-Kapitalismus verantwortlich für die Proletarisierung der Massen, die anderen für den Ausbruch von Kriegen. Das Kapital soll verantwortlich sein für Unterdrückung und Not in ärmeren Ländern. Neuerdings scheint die kapitalistische Wachstumswirtschaft ein Haupthindernis zu sein, um eine katastrophale Erderwärmung zu stoppen. Werner Plumpe hält dagegen. Als Historiker und Buchautor. Mit ihm wollen wir in den kommenden 25 Minuten sprechen über die Lehren aus der Weltwirtschaftskrise 1929. Welche Folgen der Sieg des Kapitalismus 1989 nach dem Fall der Mauer und des Ostblocks hatte. Wie es zur Weltfinanzkrise 2008 kommen konnte. Ob der Kapitalismus vereinbar ist mit dem Kampf gegen den Klimawandel. Herzlich Willkommen, Werner Plumpe. Was überzeugt Sie so am Kapitalismus? Ist das nicht ein Wirtschaftssystem für Reiche?
Werner Plumpe: Das ist es mit Sicherheit auch. Das ist überhaupt keine Frage. Aber das wäre sehr verkürzt, würde man sagen, er ist nur ein Wirtschaftssystem für Reiche. Der Kapitalismus zeichnet sich historisch dadurch aus, dass er - im Gegensatz zu allen anderen - im Grunde genommen die einfachen, nicht vermögenden Menschen mit ins Zentrum der Aktivität nimmt, weil das sind ja die Kunden. Das sind die Massenmärkte. Und die kapitalistische Massenproduktion, die sich so alles in allem seit dem siebzehnten, achtzehnten Jahrhundert durchsetzt, die hat von Anfang an eben auf den Konsum, auf den Bedarf der einfachen Menschen gesetzt. Das war vorher völlig anders. Im Mittelalter, in den älteren Zeiten, gab es sehr viele reiche Leute und es gab für die auch sehr viele Produkte. Man konnte als Reicher alles bekommen, was man wollte. Die Handwerker haben das dann geliefert, während die einfachen Menschen haben, in dem Sinne, nicht im Zentrum gestanden. Die haben von dem gelebt, was sie so bekommen konnten. Das ändert sich im Kapitalismus. Das geschieht nicht aus Altruismus, sondern deshalb, weil man damit ja auch Gewinn erzielen will. Aber den Gewinn kann man nur erzielen, wenn man Güter und Dienstleistungen anbietet, die sich eine große Masse von Menschen leisten kann.
Dem Kapitalismus wurde ja schon oft das Sterbeglöckchen geläutet. Vor 90 Jahren zum Beispiel in der Weltwirtschaftskrise. Was war damals das Problem? War das die Spekulationsblase als Auslöser, dass es nicht mehr genug Kredite gab? Was waren da die Hauptfaktoren?
Die Weltwirtschaftskrise nach 1929, die in der Tat bis heute der wohl tiefste Einschnitt in der Geschichte der kapitalistischen Wirtschaft gewesen ist, der kann sich eben nur dem erschließen, der genau auf die Umstände guckt. Das war die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Die Weltwirtschaft war durch den Ersten Weltkrieg schwer durcheinandergekommen. Die großen Nationen haben sich gegenseitig versucht zu benachteiligen. Man hat protektionistische Strukturen gehabt. Die Weltfinanzwirtschaft, die Schuldenwirtschaft, alles das hat nicht mehr funktioniert. Und in dieser Situation kommt es dann zu einer konjunkturellen Krise, die, wenn man so will, die gesamten strukturellen Probleme alle nochmal zusätzlich verschärft. Und das führt in manchen Ländern, vor allen Dingen in den USA und in Deutschland, zu erheblichen sozialen Problemen. Das war ein Desaster, was aus den besonderen Umständen besser zu begreifen ist, als aus generellen Annahmen darüber, dass der Kapitalismus am Ende wäre.
Das Erstaunliche ist, dass die Kreditmärkte nicht mehr funktionierten, die Geldwirtschaft.
Das spielt eine sehr große Rolle. Der Erste Weltkrieg hat eine Menge an Schulden hinterlassen und auch eine Menge an Reparationsverpflichtungen, die Deutschland erfüllen musste gegenüber seinen ehemaligen Kriegsgegnern. Und diese Verpflichtungen wurden 1923, 24 in eine langfristige Schuld verwandelt. Wenn man die Daten genau nimmt, hätte Deutschland bis in die 1980er Jahre pro Jahr mehrere Milliarden an England, Frankreich, Belgien und andere zahlen müssen. Das konnten die nicht und haben sich, um das zahlen zu können, das Geld in den USA geliehen. Die waren an den hohen Zinsen in Deutschland interessiert. Die Deutschen haben die Devisen dazu benutzt, um wiederum ihre Reparationsschulden zu bezahlen und die Franzosen und Engländer haben damit wiederum ihre Interalliierten-Schulden in den USA bezahlt. Das war eine Art Schuldenkarussell, das da stattgefunden hat. Das funktioniert aber nur solange das Geld, frisches Geld immer wieder neu hineinkommt. Und 1928, 29 war es in Amerika schwierig. Da wurde es interessanter für die Amerikaner, das Geld im eigenen Land anzulegen. Und als die Börse crashte 1929, da war überhaupt nicht mehr genug da, um das weiter nach Europa zu geben, damit dieses Schuldenkarussel anhält. Und folgerichtig haben Länder wie Deutschland und England und andere, Frankreich weniger, große Zahlungsprobleme bekommen, die sich dann 1931 in der Krise nochmal zugespitzt haben. Da sind die großen deutschen Banken zusammengebrochen. Die Commerzbank ist faktisch verstaatlicht worden. Dresdner Bank ist faktisch verstaatlicht worden.
Das wirtschaftliche Desaster hatte auch Einfluss auf politische Systeme.
Ja.
Welche?
Nach dem Ersten Weltkrieg hatten wir ja eine Demokratisierung in fast allen ehemaligen kriegsführenden Staaten, und wir hatten Regierungen, die dem demokratischen Konsens unterlagen. Seit die Regierungen parlamentarisch kontrolliert waren und die Parlamente aus massendemokratischen Wahlen hervorgingen, war klar, dass der Erfolg der Politik gemessen wird an dem Erfolg, den sie bei den Menschen haben wird. Das heißt, die Wahlen, der 20er Jahre waren viel stärker von Massenstimmungen abhängig, als das vorher der Fall gewesen ist. Und die wirtschaftliche Situation eines Landes, die schlägt auf die Massenstimmung unmittelbar durch. Und das können Sie in der Weimarer Republik sehr schön sehen. Wir haben eigentlich bis zur Weltwirtschaftskrise, also bis zur Reichstagswahl 1930 keine so starke Radikalisierung. Die KPD gibt es, aber die bleibt eigentlich im Bereich um zehn, zwölf Prozent. Die Nazis haben bei der Reichstagswahl 1928 zwei Prozent, zwei plus, wenig. Und erst als sich dann in der Krise 1930 herausstellt, dass der Staat den vermeintlichen Herausforderungen nicht gewachsen ist, da schlug die Stimmung langsam um. Und bei der Reichstagswahl im September 1930 bekommen die Nazis ja dann schlagartig 20 Prozent, ein bisschen drunter.
Insgesamt wirtschaftspolitisch waren zwei Politiker erfolgreich danach: Roosevelt und Hitler. Beide haben auf Pump die Wirtschaft angekurbelt.
Über Roosevelt und den New Deal gibt es in der Zwischenzeit eine intensive, große Debatte in der amerikanischen, der internationalen Forschung. Er wird heute sehr viel nüchterner beurteilt. Die Erfolge waren nicht so groß. Es kam relativ schnell wieder zu einer Zwischenkrise, und man ist heute sich doch weitgehend einig, dass die amerikanische Wirtschaft erst mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs die Krise hinter sich lässt und auf einen langfristigen Wachstumspfad einschwenkt. Da wird Amerika unbestritten zum Lieferanten der Anti-Hitler-Koalition und auch der anti-japanischen Koalition und da blüht die amerikanische Wirtschaft auf. Strenggenommen ist die Regierung Hitler die einzige gewesen, die nach 1933 zumindest von den Daten her gut dasteht. Die Arbeitslosigkeit war 1936, 37 überwunden. Die Wirtschaft ist in einem Modus der Vollbeschäftigung und auch der hohen Produktion, aber das hat sehr viel damit zu tun, dass der Staat die Rüstungsproduktion sehr stark angekurbelt hat.
Am Ende stand der Krieg.
Am Ende stand der Krieg. Die Rüstung wurde auf Pump im Wesentlichen gekauft und es war ganz klar: Ab einem bestimmten Zeitpunkt, entweder man muss radikal mit der Rüstungspolitik brechen, und das hat dann auch erhebliche ökonomische Folgen, oder es geht in den Krieg.
Die große Lehre aus der großen Krise nach Keynes: die antizyklische Haushaltspolitik.
Ja.
In Zeiten der Rezession soll der Staat investieren, in Zeiten der Hochkonjunktur soll er Schulden abbauen und sparen.
Genau. Das war in der Tat, wenn man so will, der Paukenschlag der Wirtschaftstheorie Mitte der 30er Jahre. Man hatte die Krise erlebt und niemand wusste so richtig, wie kommen wir hier wieder raus? Man hat sich gestritten. Die Liberalen waren ja traditionell eher dafür, dem Staat keine große Rolle zuzuschreiben. Und dann kommt Keynes. Und das Buch ist eingeschlagen wie eine Bombe. Der Keynes stellte kurz gesagt die These auf, dass es im Kapitalismus Situationen dauerhafter Ungleichgewichte geben kann. Die liberale Wirtschaft ging immer davon aus: Na ja, es gibt mal Ungleichgewichte, das kehrt aber automatisch ins Gleichgewicht zurück, und dann wird es schon wieder weiterlaufen. Und diesen Automatismus, dass das wieder ins Gleichgewicht zurückkehrt, den hat der Keynes in Frage gestellt. Mit dem Argument, es könnte doch eine Situation eintreten, dass die Verbraucher und die Unternehmer schlechte Zukunftserwartungen haben. Und dann behalten sie ihr Geld lieber als es auszugeben. Er nannte das »Liquiditätspräferenz«. Ja, und wenn die das nicht tun, dann wird die Wirtschaft immer kleiner und die Aussichten immer schlechter, dann hat man immer mehr „Liquiditätspräferenz“: Es ist also eine Art Streik von Unternehmern und Haushalten. Und dagegen könne nur der Staat angehen und zwar in einer Situation der Krise, indem er Kredite aufnimmt, die Kredite in die Wirtschaft gibt, auf diese Weise die Blockade aufhebt, die Zukunftserwartungen verbessert und dadurch, wenn man so will, die Pferde zum Saufen bringt und die Hunde zum Jagen trägt und dann geht das alles wieder los, dann steigen auch die Steuereinnahmen und dann kann der Staat die Schulden, die er in der Krise gemacht hat, wieder ausgleichen.
Ist ja auch einiges dran.
Seit der Nachkriegszeit war diese Vorstellung von Keynes eigentlich die konstituierende für das wirtschaftspolitische Denken überall. Man dachte sich, wenn wir so etwas wie eine Art Globalsteuerung machen, dass der Staat genau guckt,ja wo können Ungleichgewichte entstehen und da greifen wir ein, und wo sind keine, da müssen wir uns, können wir uns zurückhalten. Wenn wir das hinbekommen, dass der Staat aufgrund kluger ökonomischer Analyse an den richtigen Punkten die Stellschrauben dreht, dann wird das funktionieren. Und das haben alle vor sich hergetragen, die gingen von dieser Globalsteuerung aus. Und das hat ja in den 50er, 60er Jahren total gut funktioniert und da dachte man, das ist einfach klasse, wir haben das im Griff.
Nach dem Krieg waren die USA der große wirtschaftliche Gewinner, global gesehen, es gab aber auch das konkurrierende System. Hatte die Planwirtschaft des Ostblocks Auswirkungen auf den Kapitalismus im Westen? Eine Konkurrenzsituation?
Ich glaube, auf jeden Fall. Wir haben wieder die gleiche Situation, dass wir im Westen massendemokratische, politische Strukturen existieren, und die wissen natürlich alle, dass es im Kalten Krieg auch nicht nur um Waffen geht, sondern es geht jetzt auch um soziale Zufriedenheit, um Überzeugung davon, unter Bedingungen zu leben, die akzeptabel sind, die gut sind. Und da spielt die materielle Versorgung nicht die ausschlaggebende oder entscheidende Rolle, aber eine sehr, sehr große Rolle. Und das ist ein Wettbewerb, den beide Seiten bewusst führen. Und in dem hat der Westen sehr schnell die Nase vorn. Der Osten kann punkten mit Dingen, die wir bis in die Gegenwart hinein kennen. Dass man sagt: Wir leben in sozialer Sicherheit, bei uns gibt es keine Reichen, die soziale Ungleichheit ist geringer, bei uns gibt es die ganzen Probleme nicht, die ihr mit Wirtschaftskrisen und so weiter habt. Das wird erzählt, und das glauben auch viele Leute. Nur wenn sie sich dann unmittelbar vergleichen, dann werden sie feststellen, dass das Lebensniveau in den westlichen Staaten sich ganz schnell sehr viel positiver verändert. Im Osten konnte man, wenn man so will, das relative Elend sozial angemessen verwalten, aber es blieb deshalb trotzdem das relative soziale Elend.
Sie hatten ja selber die Situation, dass Sie mal Anhänger des Kommunismus waren. Wie haben Sie das denn hinbekommen, so geschmeidig von einem Planwirtschaftler zum Kapitalisten zu werden?
Oh, so geschmeidig ist das gar nicht gewesen. Das hat lange gedauert. Und das ist im Grunde genommen so etwas wie eine Art, könnte man sagen, sukzessive Enttäuschung gewesen. Was sehr stark war bei uns in den späten 60er und frühen 70er Jahren, war die Vorstellung, dass die Art, wie die Gesellschaft in der Bundesrepublik organisiert war, das kann nicht auf Dauer so weiter funktionieren. Und das verbunden mit einer marxistischen Theorie, die zugleich auch noch beim Studium der Wirtschaftsgeschichte half, das war schon eine Zeit lang ziemlich anregend Aber worüber man nicht hinweg kam, war, dass es in der DDR nicht funktionierte.
Wir waren davon überzeugt, die Planwirtschaft ist eigentlich in Ordnung, und das sind einfach falsche Leute, Gerontokraten, alte Leute wie Breschnew oder Menschen, die völlig humorfrei sind, wie das Politbüro der DDR. Wir haben gedacht, wenn das so unter kubanischen Verhältnissen wäre, dann wäre das viel besser. Man dachte auch, das kann jetzt nicht so funktionieren, ist halt Osteuropa und so weiter und was haben die? Die haben Kartoffeln und Sauerkraut und Schnaps. Ich habe mich dann eben auch wissenschaftlich mit all diesen Fragen beschäftigt. Und der erste Punkt, der einem dann irgendwie klar wurde, war, dass es ganz schwierig ist, eine dynamische Wirtschaft hinzubekommen, wenn Sie eine Stelle haben, die alles im Vorhinein plant. Wie soll die das denn wissen, was in zehn, 15 Jahren der Fall ist? Da guckte man sich die DDR-Automobilindustrie an und dann fand man die Entscheidung, das Politbüro hat gesagt, wir haben den Trabant, dann bleiben wir bei dem. Der fährt doch. Warum sollen wir jetzt was Neues machen? Und da merkte man, das kann man schon tun und die fahren ja auch alle Trabant, aber da ist keinerlei Dynamik drin.
Und der letzte Punkt, auf den bin ich dann relativ spät erst gekommen, dass das Betreiben einer Wirtschaft ja auch was kostet. Im Sozialismus musste das die Planorganisation machen.
Und die kostet ganz schön viel Geld.
Die DDR hatte zum Schluss gemessen an ihrer Wirtschaftsleistung eine völlig überbordende Bürokratie. Das war, wenn man so will, eine Art Selbstkannibalisierung.
1989, 90 war dann Schluss mit der Planwirtschaft, nun fehlte dem Kapitalismus auch ein wenig das Korrektiv. Dann hat die Bestie wieder ihre Fratze gezeigt.
Jawoll! Das ist wahr. Das stimmt in gewisser Weise. Allerdings erst nach einer gewissen Zeit.
Einer Anstandsfrist.
Ja, man hatte zu Anfang das Gefühl, wir haben irgendwie gewonnen. Also ich jetzt persönlich nicht.
Das Ende der Geschichte sogar?
Das Ende der Geschichte, the end of history, genau, Fukuyama und andere haben das gesagt. Man hatte das Gefühl, die Geschichte ist an einer Art Endpunkt angekommen. Alles, was jetzt noch passieren kann, sind Varianten zu einem gegebenen Thema. Variationen, aber nichts wirklich Neues mehr. Und das war allerdings, glaube ich, ein wirklich großer, großer Irrtum. Man hatte jetzt die Vorstellung, das bezeichnet man heute hier so als Neoliberalismus, dass das, was den Westen zum Erfolg geführt hat, seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, dass man das doch radikalisieren könnte. Also wenn man nur alles freisetzen würde, was an wirtschaftlichem Eigeninteresse da ist, was an Handlungschancen da ist, wenn sich der Staat da raushalten würde. Die ganze Privatisierung von öffentlichen Unternehmen, die Veränderung der öffentlichen Infrastruktur, die Deregulierung des Bankensektors und und und. Das folgte dann in den kommenden Jahren. Da steckte ja überall die Idee dahinter, je weniger wir uns da einmischen, umso freier die Akteure handeln können, umso erfolgreicher ist das Wirtschaftssystem.
Fast wieder zurück zu Adam Smith und den Urliberalen, der Markt wird alles richten und der Staat wird zum Nachtwächterstaat, der nur zuschaut.
Ja, das war Milton Friedman, der war einer der Ikonen dieser Bewegung. Der hat eben gesagt, der Markt kann eigentlich keine Fehler machen. Der Markt ist in Ordnung. Fehler passieren, wenn die Politik das und das und das falsch macht. Sie sollte sich also auf bestimmte basale Dinge zurückziehen, nämlich die Geldmenge stabil zu halten und ansonsten den Markt entscheiden zu lassen. Der wird das schon richtig machen. Aber da kann man wieder sehen, wie eine theoretisch-konzeptionell sogar ganz elegant wirkende Auffassung in der Praxis dann hart scheitert. Weil es gibt keine perfekten Märkte, es gibt keine perfekten Marktteilnehmer. Das gibt es alles gar nicht. Da ist eine Vorstellung der ökonomischen Theorie.
Und es gibt die menschliche Gier. Wenn Sie mal an die Deutsche Bank denken, an ihr aktuelles Forschungsvorhaben. Ackermann vor der Finanzkrise, der dann forderte 25 Prozent Umsatzrendite, glaube ich, von seinen Investmentbankern.
Ja.
Die sind heute ein bisschen bescheidender geworden wahrscheinlich.
Oh, die sind definitiv bescheidender geworden, wie es für alle ja gilt, die die großen Zeiten vor der Finanzkrise mitgemacht haben, da war man ja in dem festen Glauben, jetzt gibt es einen globalen Finanzmarkt, und auf dem herrschen ganz andere Regeln. Da können wir mit den traditionellen Regeln der deutschen sozialen Marktwirtschaft nicht mehr mitspielen. Hier bei uns, wir Schraubenfabrikanten und Autobauer und sonst irgendwas, wir sind irgendwie langweilig und wir wollen da raus, wir wollen da auch mitspielen. Gerade hier in Frankfurt, wo wir hier sitzen und uns unterhalten, da hat das eine große Rolle gespielt. Man wollte in der Liga der finanzkapitalistischen Welt ganz vorne in der Champions League mit dabei sein. Und insofern hat man gesetzliche Regeln aufgehoben und die Leute angereizt, Dinge zu tun, hat aber nicht damit gerechnet, das ist nun mal im Kapitalismus so, was hoch geht und boomt, das geht auch wieder runter.
Die Finanzkrise selber, die 2007, 2008 ausgebrochen ist, das war das Ergebnis eines, im Nachhinein ganz gut zu analysierenden, Zusammentreffens unterschiedlicher Faktoren. Wir hatten eine relativ starke Immobilienpreisentwicklung gehabt, eine regelrechte Blase. Die Blase war finanziert worden durch den in den 80er, 90er, 00er Jahren entwickelte neue Finanzinstrumente, die nach außen sehr elegant erschienen, intern aber eine Dynamik hatten, die niemand so richtig auf der Rechnung gehabt hat. Die Banken hatten ihr Geschäft sehr stark ausgedehnt, wollten immer größere Kredite vergeben, und um das zu können, hat man angefangen, Zweckgesellschaften zu gründen und ähnliches mehr. Und als dann die Luft raus war, plötzlich, weil die Immobilienpreise zusammengebrochen sind, ist das wie ein Kartenhaus dann ebenfalls zusammengebrochen, und die Banken standen vor gewaltigen Problemen, die sie ja zum Teil heute noch haben.
Was 2008 anders war, war die Politik.
Ja.
Man versuchte aus den Fehlern der Weltwirtschaftskrise zu lernen, die systemrelevanten Banken nicht pleitegehen zu lassen, sondern sie aufzukaufen mehr oder weniger und staatlich zu finanzieren.
Das Verhalten, dass der Staat an den Tag legt nach 2008, als er die großen Finanzmarktakteure rettet, das war nichts historisch Neues. Wenn Sie sich die Verschuldung anschauen, die die europäischen Staaten hatten, dann hätte ein Zusammenbruch der Finanzsysteme bedeutet, dass ein Staat wie Griechenland nicht mehr finanziert worden wäre. Italien wäre nicht mehr finanziert worden. Frankreich wäre nicht mehr finanziert worden. Auch die Bundesrepublik Deutschland hätte gewaltige Probleme bekommen. Ganz abgesehen davon, dass diese Probleme sich weiter fortgesetzt hätten. Dass ganze Bereiche von Volkswirtschaften plötzlich in eine Situation mittelfristiger Schwierigkeiten geraten wären. Und das wollte man auf jeden Fall verhindern. Also es ist eine sehr komplexe Situation, die die Staaten dazu gebracht hat, eigentlich die Regeln des Kapitalismus aufzuheben. In einer kapitalistischen Ökonomie behaupten sich die Akteure am Markt oder gehen unter.
Die große Zukunftsfrage ist der Klimawandel.
Ja.
Contra Wachstumswirtschaft. Das ist das neue Spannungsfeld, in dem der Kapitalismus jetzt steht. Die Gleichung: eine Wachstumswirtschaft und der Kampf gegen die Erderwärmung, das kann nicht zusammen gehen, und da der Kapitalismus immer nach Wachstum schreit und ihn zutage bringt, kann das nicht funktionieren. Ist Ihrer Auffassung nach der Kapitalismus geeignet, um die Zukunftsprobleme des Klimawandels zu lösen?
Ich glaube, kapitalistische Verfahrensweisen sind die einzigen, mit denen man etwas machen kann. Wenn wir vor der großen Herausforderung stehen, einer wachsenden Weltbevölkerung einen einigermaßen guten Lebensstandard zu garantieren, dann werden wir Methoden und Mittel der Massenproduktion von Gütern und Dienstleistungen haben müssen. Wenn wir gleichzeitig wissen, dass gerade in der Tatsache der Massenproduktion von Gütern und Dienstleistungen alle ökologischen Probleme in gewisser Weise zusammentreffen, was den Ressourcenverbrauch angeht, was die Abfallwirtschaft angeht, was den Landschaftsverbrauch angeht, was die Bedeutung von Mobilität und andere Dinge angeht, dann stehen wir heute vor dem Problem, uns die Frage zu beantworten: Wie können wir den Massenbedarf, wenn wir nicht hergehen wollen und sagen, nur Europäer kriegen das und die anderen, die sollen das nicht bekommen, also wenn wir sagen, der Massenbedarf ist etwas, was demokratisch unhintergehbar einfach gegeben ist, wenn wir den befriedigen wollen, dann sehe ich keine Möglichkeit, keine Mittel, das alleine mit Verzicht, das alleine mit Weniger zu lösen, sondern dann müssen wir nach intelligenten Wegen suchen, wie wir diese Dinge irgendwie unter einen Hut bekommen. Wir brauchen neue, intelligente technische Lösungen. Und ich sehe im Moment kaum eine Alternative zu kapitalistischen Verfahren, sich um diese Techniken zu bemühen. Die Alternative wäre eben zu sagen, die Menschheit muss schrumpfen oder sie muss den Gürtel enger schnallen oder wir müssen irgendwie versuchen, freiwilligen Verzicht zu erreichen, der relevant und bedeutend genug ist, um das alles hinzubekommen. Das halte ich allerdings alles für sehr viel unrealistischer als das Setzen auf kapitalistischen Strukturwandel, der zumindest bisher ganz gut funktioniert hat.
Herr Plumpe, vielen Dank für diese spannenden Einblicke.
Ja, ebenso, herzlichen Dank, Herr Wember.
Literatur:
Plumpe, Werner: Das kalte Herz. Kapitalismus: die Geschichte einer andauernden Revolution, Berlin 2019.

Geschichte ist Gegenwart! Der History & Politics Podcast der Körber-Stiftung
Warum Geschichte immer Gegenwart ist, besprechen wir mit unseren Gästen im History & Politics Podcast. Wir zeigen, wie uns die Geschichte hilft, die Gegenwart besser zu verstehen.
-
Is Globalization unstoppable? Insights from the Past#73 38 Min. 12. Jun 2024
-
Moldau: Perspektiven eines zerrissenen Landes#66 35 Min. 7. Mai 2024
-
The New Germany S03E06: Extremism: Defending Democracy in Past and Present#72 50 Min. 9. Apr 2024
-
Über die Geschichte einer gewaltfreien Gesellschaft#71 45 Min. 2. Apr 2024
-
The New Germany S03E05: Social Transformation: What is German?#70 53 Min. 26. Mrz 2024
-
The New Germany, S03E04: Made in Germany: Industry and Deindustrialisation#69 49 Min. 12. Mrz 2024
-
History in the Age of Disinformation#68 51 Min. 5. Mrz 2024
-
The New Germany, S03E03: Germany and the US: Cowboys and Keynesians#67 51 Min. 27. Feb 2024
-
Distance and emotion: Ukrainian historians in war times#65 53 Min. 20. Feb 2024
-
The New Germany, Season 3 - Episode 2: Germany and France: A Marriage on the Rocks#64 56 Min. 13. Feb 2024
-
The New Germany, Season 3 - Episode 1: Crisis Chancellors#63 55 Min. 30. Jan 2024
-
Technologien gegen das Vergessen#62 36 Min. 27. Jan 2024
-
Amerika – das Ende eines Traums?#61 64 Min. 12. Dez 2023
-
The New Germany, S02E07: Grenzen überwunden? Das Verhältnis zwischen Ost und West#60 84 Min. 14. Nov 2023
-
Zwischen Moral und Realpolitik: Das deutsch-israelische Verhältnis#59 46 Min. 12. Sep 2023
-
Chatting with the Past#58 47 Min. 8. Aug 2023
-
Die Arktis – Von der Friedenszone zur internationalen Konfliktzone#57 37 Min. 4. Jul 2023
-
Zeitenwende and the Return of History#56 44 Min. 8. Jun 2023
-
Polen und Europa seit 1989#55 33 Min. 30. Mai 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 6: German Politics in Flux#54 43 Min. 9. Mai 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 5: German Schuldenangst#53 46 Min. 25. Apr 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 4: Germany’s Grand Strategy#51 48 Min. 11. Apr 2023
-
Politik unter Einsatz des Körpers#52 42 Min. 6. Apr 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 3: Germany and Poland#49 47 Min. 28. Mrz 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 2: Germany and China#48 51 Min. 14. Mrz 2023
-
Das Jahr 1923 und German Schuldenangst#47 40 Min. 7. Mrz 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 1: Germany’s Russians#46 54 Min. 28. Feb 2023
-
Rechte Geschichtsbilder im Video-Gaming#45 47 Min. 15. Feb 2023
-
Asylpolitik: Eine Konfliktgeschichte#44 32 Min. 12. Jan 2023
-
Aktivist:innen in Russland: Zwischen Untergrund und Friedensnobelpreis#43 35 Min. 6. Dez 2022
-
Das Ringen um die neue Weltordnung#42 43 Min. 21. Nov 2022
-
Ukraine: Eine Nation unter Beschuss#41 45 Min. 21. Okt 2022
-
Wohnen – wo Privates politisch ist#40 32 Min. 6. Sep 2022
-
The New Germany, Part 4: The Lid of History#39 52 Min. 22. Aug 2022
-
The New Germany, Part 3: German Energy Policy and Russian Gas#38 43 Min. 8. Aug 2022
-
The New Germany, Part 2: A Love-Hate Relationship#36 57 Min. 25. Jul 2022
-
Russia: When History Becomes a Weapon (Englische Folge)#34 40 Min. 19. Jul 2022
-
The New Germany, Part 1: The Bundeswehr and Germany's Mindset#35 42 Min. 12. Jul 2022
-
Erinnerung hat Konfliktpotenzial – Wie sich unser Blick auf Geschichte ändert#33 48 Min. 7. Jun 2022
-
Krieg in der Ukraine: ein historischer Wendepunkt?#32 35 Min. 31. Mai 2022
-
Geschichte und Erinnerung in Games#31 28 Min. 3. Mai 2022
-
Belarus: Was bleibt von den Protesten 2020?#30 30 Min. 8. Mrz 2022
-
Sind Russland und China heute Imperien?#29 39 Min. 8. Feb 2022
-
#30PostSovietYears: Kann Kunst versöhnen?#28 39 Min. 30. Nov 2021
-
China – Modernisierung zwischen Isolation und Öffnung#27 39 Min. 28. Okt 2021
-
Deutschland und Polen - Geschichte und Zukunft einer guten Nachbarschaft#26 42 Min. 23. Sep 2021
-
Russland - Großmacht mit historisch gewachsenem Sonderstatus?#25 33 Min. 24. Jun 2021
-
Belarus – Über Proteste, Demokratie und Diaspora#24 39 Min. 29. Apr 2021
-
Die Vorgeschichte der Hohenzollern-Debatte. Adel, Nationalsozialismus und Mythenbildung nach 1945.#23 54 Min. 25. Mrz 2021
-
Jüdisches Leben in Deutschland seit 1945#20 50 Min. 25. Feb 2021
-
Deutschland und Frankreich – Fremde Freunde?#22 40 Min. 27. Jan 2021
-
Geschichtsvermittlung ist eine Zukunftsbranche#21 27 Min. 17. Dez 2020
-
Tatjana Tönsmeyer: Das europäische Erbe der NS-Besatzungsherrschaft#19 34 Min. 26. Nov 2020
-
Natasha A. Kelly: Rassismus und die Geschichte Schwarzer Menschen in Deutschland#18 40 Min. 19. Okt 2020
-
Sandra Günter: Sport macht Gesellschaft?#17 37 Min. 24. Sep 2020
-
Stefanie Middendorf: Geschichte der Staatsverschuldung: Kredite für die öffentliche Hand#16 40 Min. 27. Aug 2020
-
Helene von Bismarck: Großbritannien und die EU – ein historisches Missverständnis?#15 34 Min. 27. Jul 2020
-
Aleida Assmann: Was hält Europas Sterne zusammen?#14 24 Min. 25. Jun 2020
-
Birte Förster: Rolle rückwärts bei der Gleichberechtigung?#13 29 Min. 8. Jun 2020
-
Till van Rahden: Demokratie in Krisenzeiten#12 30 Min. 6. Mai 2020
-
Elke Gryglewski: Alles gesagt, alles gezeigt?#11 23 Min. 17. Apr 2020
-
Frank Uekoetter: Pandemien und Politik#10 25 Min. 27. Mrz 2020
-
Mary Elise Sarotte: Die NATO-Osterweiterung.#9 29 Min. 20. Nov 2019
-
Werner Plumpe: Die Kraft des Kapitalismus.#8 21 Min. 23. Okt 2019
-
Ilko-Sascha Kowalczuk: 30 Jahre Mauerfall – und nun?#7 23 Min. 1. Okt 2019
-
Claudia Weber: Kriegsausbruch 1939#6 24 Min. 11. Jul 2019
-
Jason Stanley: Faschismus damals und heute#5 18 Min. 4. Jul 2019
-
Philip Murphy: Rule Britannia?#4 24 Min. 27. Jun 2019
-
Hedwig Richter: Volksbegehren oder Staatsgewalt?#3 22 Min. 20. Jun 2019
-
David Ranan: Israelkritik und Antisemitismus#2 22 Min. 13. Jun 2019
-
Eckart Conze: Von Versailles 1919 zu den „Neuen Kriegen“#1 28 Min. 28. Mai 2019