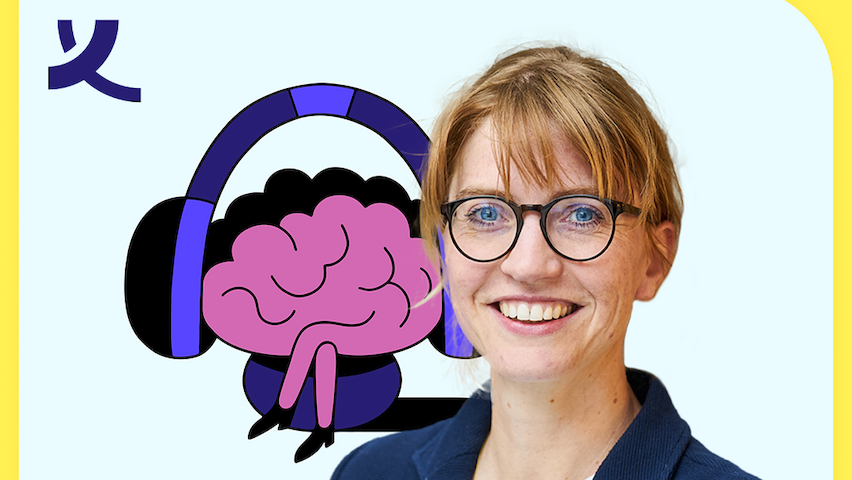Tatjana Tönsmeyer: Das europäische Erbe der NS-Besatzungsherrschaft
Geschichte ist Gegenwart! Der History & Politics Podcast der Körber-Stiftung
Weiße Flecken in der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg
Welche Alltagserfahrungen machten Millionen von Menschen in Ost- und Westeuropa während des Zweiten Weltkriegs unter deutscher Besatzung? Wie wird in Deutschland heute an die Besatzungsgeschichte weiter Teile Europas erinnert und welches Potenzial bietet das Thema für die Verständigung mit den ehemals besetzten Ländern? Darüber spricht die Historikerin Tatjana Tönsmeyer im Gedenkjahr 2020 im History & Politics Podcast.
https://www.koerber-stiftung.de/koerber-history-forum https://twitter.com/koerbergp https://www.facebook.com/KoerberStiftung/
„Für die Bundesrepublik ist der Leitbegriff der Krieg. Für viele unserer europäischen Nachbarn ist der Leitbegriff der der Besatzung, der Okkupation. Diese Jahreszahlen könnten unsere Erinnerung weiten, die Themen weiten, die dabei zur Sprache kommen. Gegenwärtig haben wir aber in der Bundesrepublik eine Erinnerung, die stark auf Krieg ausgerichtet ist und sehr viel weniger auf Besatzung.“
Tatjana Tönsmeyer, Historikerin
Hallo und herzlich willkommen! Dies ist eine neue Folge von History and Politics, dem Podcast der Körber-Stiftung zu Geschichte und Politik. Wie jedes Mal sprechen wir auch heute mit einem Gast über ein aktuelles politisches oder gesellschaftliches Thema. Und fragen, wie uns die Vergangenheit dabei helfen kann, die Gegenwart besser zu verstehen. Ich bin Gabriele Woidelko und freue mich, dass Sie bei uns reinhören.
Heute geht es darum, wie Millionen von Menschen in Europa während des Zweiten Weltkriegs die deutsche Besatzungsherrschaft erlebt haben und welche Bedeutung dieses Thema noch heute für Gesellschaft und Politik in Deutschland und in den ehemals besetzten Ländern hat.
75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieg diskutieren wir in dieser Folge über die zahlenmäßige Dimension und über den Alltag unter nationalsozialistischer Besatzung. Wo lagen die Gemeinsamkeiten, wo die Unterschiede der Besatzungspolitik in West- und Osteuropa? Wie kann ein europäisches Erinnern heute, 75 Jahre später, aussehen? Und wie balancieren wir ein europäisches Erinnern gegen das legitime Bedürfnis nach Würdigung für Leid und Opfer auf nationaler Ebene aus?
Darüber habe ich mit der Historikerin Tatjana Tönsmeyer gesprochen. Professorin Tatjana Tönsmeyer ist Inhaberin des Lehrstuhls für Neuere und Neueste Geschichte an der Bergischen Universität Wuppertal. Sie ist Leiterin des dortigen Forschungsprojekts zu Besatzungsgesellschaften im Zweiten Weltkrieg und Co-Leiterin eines internationalen Forschungs- und Editionsprojekts zu Alltagserfahrungen in Europa unter deutscher Besatzung.
Frau Tönsmeyer, wir haben das Jahr 2020 und wir hatten einen großen und wichtigen Jahrestag, nämlich 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs, der ist aber ziemlich unbemerkt an uns vorübergezogen aufgrund der Corona-Pandemie. Wie wichtig sind aus Ihrer Sicht solche Jahrestage, wenn es um die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg geht?
Ich glaube schon, dass die Jahrestage für die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg ziemlich wichtig sind, es sind Daten, mit denen wir als Gesellschaft markieren, was uns wichtig ist. Und ich glaube, genau wegen dieser Markierung von Wichtigkeit, brauchen solche Jahrestage auch Öffentlichkeit. Und entsprechend ist das tatsächlich ein Einschnitt, wenn wir durch eine Pandemie diese Form von Öffentlichkeit, die wir bis jetzt gekannt haben, so nicht gestalten können. Das ist natürlich naheliegend, gar keine Frage, aber grundsätzlich würde ich sagen, braucht eine Gesellschaft diese öffentliche Form von Erinnerung.
Sie sagen, grundsätzlich brauchen wir die öffentliche Form von Erinnerung. Sie beschäftigen sich alt Historikerin schwerpunktmäßig mit Besatzungserfahrungen im Rahmen des Zweiten Weltkriegs. Mich würde interessieren, wenn Sie sagen, grundsätzlich sind solche Jahrestage für die gesellschaftliche Orientierung, für die Erinnerung, wichtig, trifft das auch auf Ihr Thema, auf die Besatzungserfahrungen, zu?
Ich würde sagen, es ist wichtig, dass sie nochmal stärker ins Bewusstsein rücken als das gegenwärtig der Fall ist. Und das bringt uns quasi ins Zentrum unseres Gegenstandes: Wenn wir uns angucken, was wir eigentlich erinnern, wenn wir uns an den Nationalsozialismus und an den Zweiten Weltkrieg erinnern, dann haben wir vor allen Dingen kriegsbezogene Ereignisse und Massenverbrechen vor Augen, das ist vollkommen richtig, das ist wichtig und notwendig. Es gibt aber Erfahrungen, die Menschen in den Kriegsjahren außerhalb von Deutschland mit deutscher Besatzung gemacht haben, die sich nicht unmittelbar daran andocken lassen. Besatzungserfahrungen sind Erfahrungen des Alltags, sie sind durchaus gravierende Erfahrungen, aber was ist das typische Datum für Hunger? Was ist das typische Datum für Familienzerstörung? Was ist das typische Datum für Verschleppung zur Zwangsarbeit? Das heißt, wir haben bestimmte Daten, die unsere Erinnerung strukturieren. Diese sind sehr häufig kriegsbezogen, das heißt, sie sind nicht unbedingt besatzungsbezogen und sie sind Daten einer politischen Geschichte und nicht so sehr Daten einer Erfahrungsgeschichte. Insofern ist das Erinnern wichtig, aber es gibt in unserer Konzentration auf bestimmte Jahreszahlen Phänomene, die auch der Erinnerung wert wären, die dadurch nicht im Vordergrund stehen.
Und wenn ich Sie richtig verstehe, gilt genau das für das Thema Besatzungserfahrungen. Es gibt nicht den einen Tag, den einen Anlass, den wir nutzen, um an Besatzung erinnern zu können?
Ich glaube, es wäre recht unkompliziert diese Kriegsdaten zu verbinden und festzulegen, dass man dort auch an Besatzung erinnert. Im letzten Jahr konnten wir da eine Veränderung beobachten: Der Überfall auf Polen jährte sich – und die deutsche Presselandschaft berichtete breit darüber. Man fragte sich: Wo hat dieser Krieg eigentlich angefangen? Und es ist nicht die Westerplatte, sondern vorher noch ist es Wieluń. Und was macht eigentlich Krieg und Besatzung mit einem Ort? Für die Bundesrepublik ist der Leitbegriff der Krieg. Für viele unserer europäischen Nachbarn ist der Leitbegriff der der Besatzung, der Okkupation. Diese Jahreszahlen könnten unsere Erinnerung weiten, die Themen weiten, die dabei zur Sprache kommen. Gegenwärtig haben wir aber in der Bundesrepublik eine Erinnerung, die stark auf Krieg ausgerichtet ist und sehr viel weniger auf Besatzung.
Lassen Sie uns nochmal ein bisschen stärker eintauchen in das, was Besatzungserfahrung eigentlich bedeutet. Tony Judt, der US-amerikanische Historiker hat von dem „War of Occupation“, also dem Krieg der Okkupation, gesprochen. Können Sie kurz sagen, über welche Dimensionen wir sprechen, wenn wir über Besatzungserfahrungen sprechen? Wie viele Menschen haben in Europa Besatzungserfahrungen im Zweiten Weltkrieg erlebt?
Ich glaube, es gibt verschiedene Ebenen, wenn wir über Zahlen und Besatzungserfahrungen reden. Das erste, was man sich klarmachen muss, ist, dass auf dem Höhepunkt deutscher Machtausdehnung, also etwa Ende 1941/Anfang 1942, 220-230 Millionen Menschen unter Besatzung zwischen Nordnorwegen und den Mittelmeerinseln bzw. der französischen Atlantikküste und Gebieten weit im Inneren der Sowjetunion bzw. dann Russlands, so weit eben, wie die deutschen Truppen gekommen sind, lebten. Mit 220-230 Millionen sprechen wir von enormen Zahlen, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man sich vergegenwärtigen sollte, dass zwischen 1939 und 1945 etwa 36-36,5 Millionen Menschen aus kriegsbezogenen Gründen starben und mehr als die Hälfte von diesen gut 36 Millionen, nämlich 19 Millionen Menschen, starben als Zivilistinnen und Zivilisten. Diese Zahl inkludiert die 6 Millionen Opfer der Shoa, aber sie inkludiert auch viele nichtjüdische Menschen. Was ganz wichtig ist, was man sich verdeutlichen sollte, ist, dass in vielen Ländern die Zahl der zivilen Opfer deutlich höher ist als die der militärischen, das gilt trotz der exorbitanten militärischen Opfer auch für die Sowjetunion, das gilt für Polen, das ehemalige Jugoslawien, für Griechenland, für Ungarn, für Frankreich, für die Niederlande, für Belgien und auch für Norwegen. Es gilt für alle besetzten Länder im großen Unterschied zu Deutschland und Großbritannien als kriegführende und während der Kriegsjahre nicht besetzte Länder. Sie haben höhere Opferzahlen unter den Militärs. Besatzungsgesellschaften haben also relativ gesehen mehr Opfer unter der Zivilbevölkerung, kriegführende Staaten haben höhere Zahlen unter den Soldaten.
Wenn wir über die Dimensionen sprechen, dann frage ich mich schon, warum es in Deutschland ja doch relativ lange gedauert hat, bis wir an einen Punkt gekommen sind, um an diese Besatzungserfahrungen und die Opfer in verschiedenen europäischen Ländern zu erinnern. Wie erklären Sie sich das?
Ich glaube, dafür benötigt man eine komplexe Antwort mit mehreren Strängen. Wir haben ja auch beobachten müssen oder wir sehen es im Rückblick, wie lange es gedauert hat, bis es in der Bundesrepublik eine Erinnerung an die Shoa, und bis es auch eine dezidierte Forschung zur Shoa gegeben hat. Für Besatzung gilt etwas Ähnliches. Das eine ist, wenn wir es eher chronologisch angehen, dann haben sich 1945 viele Menschen in Deutschland erstens nicht als befreit empfunden, sondern als besiegt, sie haben das als Schmach empfunden in Teilen, sie haben sich selber als Opfer empfunden, ob nun des Alliierten Bombenkrieges oder tatsächlich auch als Opfer des NS-Regimes. Es ist noch gar nicht so lange her, wenn Sie in politisch-historische Nachschlagewerke gucken, aber auch zum Beispiel in den Brockhaus, dann kriegen Sie unter einem Eintrag „Besatzung“ erklärt, was das ist, und die historischen Beispiele kommen aus Deutschland, aus dem Deutschland nach 1945. Es gibt also eine wenig reflektierte Vorstellung, dass wir besetzt waren. Es tritt in den Hintergrund, dass wir vorher Besatzer waren. Es gibt ein mühsames Hineinkommen in eine Beschäftigung mit der Nachgeschichte. In die Aufarbeitung, in die Frage von Gerichtsverfahren, die Frage von Amnestierung, von Entschädigung und so weiter, und ein großer Teil derer, die Opfer von Besatzungsherrschaft waren, und zwar von der Besatzungsherrschaft, die besonders blutig und brutal waren, lebten hinter dem Eisernen Vorhang, also lebten in kommunistisch regierten Staaten und waren damit Opfer, denen man im Zweifelsfall auch unterstellt hat, dass das, was sie berichteten, kommunistische Propaganda sei. So könnten wir das weiter durchdeklinieren und würden sehen, wie dieses Wissen, was ja deutsche Soldaten mit nach Hause gebracht haben, nur sehr am Rande ein Thema in der Bundesrepublik wurde, bis es tatsächlich aus dem Bewusstsein und auch aus dem Wissen verschwunden ist.
Wenn Sie über die Staaten hinter dem ehemaligen Eisernen Vorhang sprechen, über Mittel- und Osteuropa, dann würde mich interessieren, ob Sie einen Zeitpunkt ausmachen können, an dem die Debatte über Besatzungserfahrungen dort auch in Deutschland begonnen hat. Welche Rolle spielen aus Ihrer Sicht die Diskussionen um die Entschädigung der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die Anfang der 2000er Jahre angefangen haben?
Ich bin nicht ganz sicher, sicherlich sind die Phänomene vielfältiger. Ich glaube, was die Diskussionen um Entschädigungen von Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen gebracht hat, ist tatsächlich Empathie für das Leiden dieser Menschen, die zum Teil ja schon in sehr jungen Jahren fast noch als Kinder verschleppt worden sind, die unter erbärmlichen Bedingungen, vor allem dann im Deutschen Reich, arbeiten mussten. Es hat also zum einen Empathie für diese Menschen gebracht und zum anderen hat es das Wissen um die Zwangsarbeit, die in Deutschland geleistet werden musste, enorm erweitert. Aber wir stellen auch fest, dass wir über die Zwangsarbeit, die in den besetzten Ländern zu leisten war, als Folge von Besatzungsherrschaft, immer noch verhältnismäßig wenig wissen. Wir hatten, auch das sind unglaubliche Zahlen, 36 Millionen sogenannte unfreie Arbeitsverhältnisse in den deutsch besetzten Gebieten. 36 Millionen von 220 Millionen unter Besatzung lebenden Menschen. Wir reden hier von 15 bis 18 Prozent der Gesamtbevölkerung. Wir wissen viel über die, die nach Deutschland kommen mussten. Wir wissen wenig über die, die in besetzten Gebieten arbeiten mussten, auch das können im Zweifelsfall Verschleppungen gewesen sein. Von daher, ja, Empathie und auch Wissen in Bezug auf Deutschland konnten sich eventuell daraus entwickeln, doch das Phänomen ist viel größer und über den nichtdeutschen und nicht in Deutschland stattfindenden Teil wissen wir immer noch verhältnismäßig wenig.
Also haben wir da an dieser Stelle, wenn ich Sie da richtig interpretiere, vielleicht auch eine Chance vertan oder zumindest nicht so genutzt, wie wir sie hätten nutzen können?
Wir haben sehr stark auf Deutschland fokussiert gedacht und diskutiert und auch geforscht. Sie haben vorhin Tony Judt zitiert. Und Tony Judt sagt auch in diesem Zusammenhang, dass unfreiwillige Arbeitsmigration die vorrangige soziale Erfahrung für viele Menschen unter Besatzung war. Und diese unfreiwillige Arbeitsmigration ist eben nicht nur die nach Deutschland, sondern auch die in den besetzten Gebieten. Auf der Forschungsebene wissen wir immer noch extrem wenig, wie das funktioniert hat. Wir wissen relativ viel über die deutschen Strukturen. Wir wissen etwas über Sauckel und diesen wahnsinnigen deutschen Arbeitskräftebedarf und den Aufbau von Arbeitsämtern, also deutschen Arbeitsämtern in den besetzten Gebieten, aber diese unendlichen sogenannten Auskämmaktionen, die in jedem Industriebetrieb gemacht worden sind, sind noch immer nicht genug aufgearbeitet. Ich würde wirklich gerne wissen, wenn man ein Rüstungsarbeiter im Protektorat war, ging man morgens in die Fabrik und hatte Angst, so einer Auskämmaktion zum Opfer zu fallen und abends nicht nach Hause zu kommen, weil man nach Deutschland oder irgendwo anders in ein besetztes Gebiet transportiert wurde? Wir wissen darüber nichts. Ich finde, das ist kein kleines Thema, das betraf Millionen von Menschen. Wir beide haben uns zu Anfangs gefragt, woran wir uns eigentlich erinnern. Und ich glaube, wir müssen erst wissen, damit wir wissen, woran wir uns erinnern könnten.
Das ist ein gutes Stichwort Frau Tönsmeyer, dieses „wir müssen erst wissen“. Sie beschäftigen sich ja sehr intensiv mit den Besatzungserfahrungen, gerade mit der Perspektive auf europäische Nachbarländer. Welche Art von neuem Blick auf die Geschichte des Zweiten Weltkriegs eröffnet Ihnen denn diese Art der Beschäftigung mit den Besatzungserfahrungen?
Je mehr man sich mit Besatzungserfahrungen beschäftigt, desto mehr erkennt man, dass Besatzung ein Phänomen ist, was buchstäblich in jedes Detail des Alltags hineinwirkt. Solange wir eine Kriegsgeschichte schreiben, haben wir zurecht natürlich eine Geschichte der großen Zahlen und der vielen Opfer. Diese unendliche Zahl der Opfer verstellt den Blick darauf, dass auch diejenigen, die das überlebt haben, sich alle tagtäglich mit Besatzung auseinandersetzen mussten, und sich selbst da auseinandersetzen mussten, wo gar keine Deutschen anwesend waren.
Was heißt das ganz konkret vor Ort, sich mit Besatzung auseinandersetzen zu müssen?
Wir müssten eigentlich west- und osteuropäische Beispiele nochmal auseinanderdividieren, aber wenn ich auf einer allgemeinen Ebene bleibe, dann sind durch Kriegszerstörungen, durch deutsche Ausbeutungspläne auf dem Gebiet der besetzten Sowjetunion, durch die Versorgung der Wehrmacht „aus dem Land“, durch Hungerpolitik in dem ganzen besetzten Europa – Dänemark ist eine Ausnahme – sehr schnell ein Mangel und Versorgungsschwierigkeiten eingetreten. Und diese Versorgungsschwierigkeiten wurden tödlich, so dass auf dem Gebiet der besetzten Sowjetunion, aber auch in Griechenland Menschen dem Hunger zum Opfer fielen. Auch in Westeuropa, wie beispielsweise in den Niederlanden im sogenannten Hungerwinter, gab es Todesopfer durch Hunger und auch ein Land wie Frankreich erfuhr Mangel. Menschen in Belgien schrieben in ihr Tagebuch, dass sie nach zwei Jahren Besatzung 10, 12, 15 Kilo abgenommen haben. Also Mangel ist da und Mangel ist eine europäische Erfahrung und den haben Sie, auch wenn kein Soldat anwesend ist.
Nun gibt es ja diese vergleichbaren Erfahrungen: Wenn wir den gesamteuropäischen Kontext betrachten, dann ist es schon nochmal ein Unterschied, ob wir nach West- oder Osteuropa schauen. In Osteuropa haben die Nationalsozialisten einen rassistisch motivierten Vernichtungskrieg geführt. Mich würde interessieren, inwieweit Sie da auch mit Blick auf die Besatzungserfahrungen einen Unterschied machen können und wollen. Was war anders in Osteuropa?
Es gibt die Unterschiede in West und in Ost. Ich glaube, dass Gemeinsame ist der Mangel, den gibt es in West und in Ost. Die Unterschiede sind die Ausprägung und die Motivation dahinter. Sie haben Mangel cum grano salis gesprochen im Westen und Sie haben Hunger und Hungertote im Osten. Einen Unterschied gibt es auch bei der Motivation. Sie haben eher eine Ausbeutungsmotivation in West- und Nordeuropa und Sie haben rassistische Bevölkerungspolitik und Hungerpolitik in Osteuropa. Ganz deutlich kann man das an dem Beispiel von Rationen sehen: In ganz Europa gibt es Rationen, also das, was man in den Geschäften frei kaufen kann und das reicht nirgendwo sinnvoll zum Überleben. In Frankreich sind die Rationen in der Hand der französischen Behörden und Juden kriegen die gleichen Rationen. Französische Juden sind Staatsbürger und kriegen die gleichen Rationen wie nichtjüdische französische Staatsbürger. Das ist eine völlig andere Situation im Osten Europas. Im Osten Europas ist die Verteilung da, wo es Rationen gibt, in der Hand der deutschen Besatzungsverwaltung und in der Höhe der Rationen wird deutlich gestaffelt. Deutsche, sogenannte Reichs- oder Volksdeutsche, kriegen die höchsten Rationen, dann geht es um Schwerstarbeit, Normalarbeiten, Nichtarbeitende und die niedrigsten Rationen bekommen Juden. Hier spricht man von einer Staffelung. Diese rassistische Staffelung übergreift alle Gruppen der Gesellschaft und sie folgt den rassistischen Kategorisierungen der Besatzer. Da ist dieser Unterschied in West und Ost deutlich vorhanden.
Dann lassen Sie uns mal darüber sprechen, was diese Unterschiedlichkeit, die Sie beschrieben haben, ausmacht für den heutigen Dialog und für die internationale Verständigung über dieses Thema Besatzungserfahrungen.
Also ich glaube, was man immer herausstellen muss, ist die vielfach besondere Brutalität, die besondere Gewalttätigkeit. Wir reden nicht umsonst von Vernichtungskrieg. Darin unterscheiden sich die Erfahrungen. Das ist fraglos ein Punkt, und jede Diskussion, jedes Erinnern, auch gegebenenfalls Dokumentationen müssen diesen Unterschied beschreiben, daran kann es überhaupt keinen Zweifel geben. Ich würde gleichwohl sagen, dass es aber auch Ähnlichkeiten gibt, die man beschreiben kann. Und ich glaube auch, dass in diesen Ähnlichkeiten eine europäische Gemeinsamkeit, was die Erfahrungen im Kern ausmacht, liegt. Wir haben gerade über die Rationen gesprochen und wenn ich dahin nochmal zurückkommen darf, dann sind Menschen überall in Europa über die Rationen nach deutschen Vorstellungen kategorisiert worden, das heißt, überall in Europa haben Menschen mehr Lebensmittel bekommen und bessere Überlebenschancen gehabt, wenn sie Rüstungsarbeiter waren, also eher Frauen als Männer. Und überall haben sie weniger bekommen, wenn sie nach diesen utilitaristischen Kriterien für Deutsche „nicht so nützlich“ waren. Was aus einer deutschen Perspektive wichtig ist, ist, dass das Leid vorhanden ist und spezifisch erinnert werden muss. Aber eine Sache, die immer gelten sollte, ist die Anerkennung von Leid, besonders in Osteuropa, aber auch in Westeuropa.
Glauben Sie denn, dass wir heute in der europäischen Debatte über die Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg, wirklich miteinander in ein Gespräch kommen können?
Ich würde es mir jedenfalls sehr wünschen. Ich glaube, dass es vielleicht vor zehn Jahren einfacher gewesen wäre, als es möglicherweise heutzutage ist. Wir haben vorhin davon gesprochen, welche Chancen es zu bestimmten Zeitpunkten gegeben hat, die vielleicht auch nicht genutzt worden sind. Gleichwohl hat der Deutsche Bundestag Anfang Oktober verabschiedet, dass eine Gedenk-, Erinnerungs- und Dokumentationsstätte für die Opfer des deutschen Vernichtungskrieges und für bisher wenig beachtete Opfergruppen des Nationalsozialismus errichtet werden soll. Ich fand das eigentlich schade, dass die Debatte, die es im Bundestag gegeben hat, eher wenig Aufmerksamkeit in den Medien gefunden hat. Denn in dieser Debatte konnte man hören, dass unter der ganz großen Mehrheit der Parlamentarierinnen und Parlamentarier, also die der demokratischen Parteien, die sich dazu geäußert haben, ein klares Bewusstsein für die besonderen und langandauernden Leiden in Osteuropa herrschte. Neben dem Bewusstsein für, zum Beispiel, Polen, was als erstes besetzt worden war, gibt es aber auch den Blick nach Norwegen, in die Niederlande und nach Frankreich und zu deren Leidenserfahrungen. Diese Debatte habe ich insgesamt doch als differenziert wahrgenommen und das lässt mich denken, dass es aus einer deutschen Perspektive doch ein gewachsenes Bewusstsein für diese verschiedenen Leidenserfahrungen gibt.
Nun gehören ja zu einem Dialog oder gar zu einem Gespräch, das mehrere Seiten einbezieht als nur zwei, eben auch immer alle Seiten. Wir erleben ja in den letzten Jahren in verschiedenen Ländern Europas eine Geschichtserzählung, die sehr stark oder wieder stärker auf eigene Opfer und eigenes Leid fokussiert. Polen wird da manchmal genannt, aber es gibt auch andere Länder, in denen sehr stark auf die eigenen Opfer und das eigene Leid angespielt wird oder wo das eigene Leid im Vordergrund steht. Nun könnte man einerseits sagen, das ist eine legitime Reaktion darauf, dass dieses Leid eben doch lange, zumindest aus Deutschland heraus, nicht genug anerkannt wurde, aber andererseits macht genau das natürlich auch einen Dialog, ein grenzübergreifendes Gespräch schwierig. Wie schätzen Sie das ein? Wie sind denn die Chancen, dass wir uns nicht nur in Deutschland mit der Thematik auseinandersetzen und mit den Opfern von Besatzungen, sondern dass wir da auch in einen Dialog mit den Nachbarländern kommen?
Ich selbst bin ja involviert in ein Quelleneditions- und Forschungsprojekt, in dem wir diese Besatzungserfahrungen dokumentieren und erforschen. Und es ist ein Projekt, an dem etwa 20 Kolleginnen und Kollegen aus all den Ländern beteiligt sind, die ehemals besetzt waren. Das Projekt läuft nun schon über mehrere Jahre und natürlich haben wir uns am Anfang und über die ganze Projektlaufzeit immer wieder darüber unterhalten, was die Besonderheiten eines Landes sind und was das europäisch Gemeinsame oder Ähnliche ist. Ich bin aus diesem Projekt eigentlich mit einem doch ziemlich großen Optimismus, wie soll ich es anders sagen, ausgestattet worden, oder versehen worden, insofern, als ich finde, dass das insgesamt sehr fruchtbare Diskussionen gewesen sind und dass wir tatsächlich immer wieder nach Vergleichbarkeiten gefragt haben. Es gibt also diese Konstellationen von Forscherinnen und Forschern, in denen man diese Dinge gut diskutieren kann. Natürlich gibt es einen geschichtspolitischen Rahmen. Das, was Sie beschreiben, also Geschichtspolitik und Identitätspolitik, deswegen habe ich gesagt, dass es vor zehn Jahren vermutlich anders gewesen wäre und, dass wir diesen Zeitpunkt verpasst haben. Aber was soll denn die Konsequenz daraus sein? Weil wir den Zeitpunkt verpasst haben, lassen wir jetzt nochmal zehn Jahre vergehen?
Der geschichtspolitische Rahmen existiert, dennoch entnehme ich Ihren Äußerungen, dass im Rahmen der wissenschaftlichen Debatte im Rahmen grenzübergreifender Forschungsprojekte ein sehr differenzierter Dialog über Grenzen hinweg weiterhin möglich ist.
Wir haben vorhin über Wissen geredet und, dass es ein unzureichendes Wissen darüber gibt, was die Besatzung, was der zweite Weltkrieg für Polen bedeutet hat. Es bedeutet aber nicht, dass ich alle Weiterungen dieser Geschichtspolitik übernehme und heißt auch nicht, dass ich diese auch nicht infrage stellen kann, und dass ich Themen, die als heikel empfunden werden, wie die Beteiligung einheimischer Kräfte, was als das Heikelste empfunden wird, ausblenden würde, denn das geht nicht, weil sie Teil von der Besatzungsherrschaft sind. Im gesamten besetzten Europa haben deutsche Stellen auf einheimische Kräfte zur Durchsetzung ihrer Besatzungspolitik zurückgegriffen und das hat andere Auswirkungen in Osteuropa als in Westeuropa, weil die Besatzungsherrschaft eine andere war, genau das muss auch thematisiert werden und das sind schmerzhafte Themen. Aus deutscher Perspektive würde ich denken, es wäre ein guter erster Schritt, wenn wir anerkennen würden, dass diese Themen schmerzhaft sind und von da aus mit den vorhandenen Quellen Forschung betreiben, der Meinung bin ich sehr deutlich.
Die Forschung sollte gemacht werden, sagen Sie, dann ist ja aber die Frage, wie es von der Forschung zu einer breiteren öffentlichen Debatte kommt oder zu einer Anerkennung des Leids, was Sie gerade beschrieben haben. In diesem Zusammenhang ist ja eine ganz interessante Entwicklung, dass der Bundestag kürzlich eben nicht nur die Errichtung dieses Gedenkortes an die Opfer, also an alle Opfer des deutschen NS-Besatzungsregimes, beschlossen hat, sondern eben auch zwei Wochen später die Errichtung des sogenannten Polendenkmals in Berlin, also eines Ortes, der speziell an die polnischen Opfer des Zweiten Weltkriegs erinnert. Ist das aus Ihrer Sicht dann der Schritt, der dazu führt, dass wir eben auch hier in Deutschland speziell dieses polnische Leid anerkennen?
Als Historikerin hätte ich mir eher gewünscht, dass wir den europäischen Weg gewählt hätten, dass wir sozusagen Gemeinsamkeiten und Unterschiede in einem Zusammenhang dargestellt hätten oder stellen werden. Denn es ist ja nicht so, dass diese übergreifende Gedenkstätte quasi alle Nationen ohne Polen berücksichtigen soll und dann nochmal ein Denkmal, was besonders und nur den Polen gewidmet ist, errichtet wird. Von daher wäre als Historikerin meine Perspektive, dass diese europäische Dimension das ist, was ich bevorzugen würde. Gleichwohl, Geschichte bewegt sich und auch Geschichtswissenschaft bewegt sich in einem erinnerungspolitischen Raum.
Rechnen Sie als Historikerin damit, dass es dann jetzt nach dem Beschluss für das Polendenkmal weitere Initiativen geben wird, die vielleicht Gedenkorte für andere Opfer einfordern, beispielsweise für ukrainische oder für belarussische Opfer?
Was ich für wichtig halte, wäre zu gucken, dass die verschiedenen Akteure eingebunden werden. In dem Moment, wo Opferkonkurrenzen entstehen und das ist einfach ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss, kann ein Gespräch schwieriger werden. Von daher ist es, glaube ich, eine große Aufgabe, die da entsteht, dieses europäische Erinnern zu realisieren.
Wir haben am Anfang unseres Gesprächs davon gesprochen, dass 2020 ein ganz besonderes Jahr ist, nicht nur wegen der Corona-Pandemie, sondern eben auch, weil die Corona-Pandemie uns an vielem hindert, auch was Erinnerung und Gedenken betrifft. Inwieweit können uns die digitalen Möglichkeiten, vielleicht bei Ihrem europäischen Erinnerungsprojekt an Besatzung, helfen, auch gesellschaftlich?
Also wenn ich die Antwort vielleicht mal aus meinem eigenen Projekt heraus entwickeln darf, dann wird das, was daraus entsteht, die Quellenedition auch eine digitale Komponente haben. Die Quellen werden im Übrigen auf Englisch publiziert, sie stehen im Netz und sie sind zugänglich und sie sind als eine europäische Sammlung aus den verschiedenen europäischen Ländern zugänglich. Die Digitalisierung hilft uns sicherlich dabei, Zugänge zu erleichtern, dennoch sind wir mit diesem Lernprozess noch lange nicht durch. Ich glaube, auch wenn wir irgendwann in einer Zeit nach der Pandemie sein werden, dass wir uns auch dann darüber Gedanken machen, dass die Bedeutung authentischer Orte wirklich eine zentrale ist und ich persönlich würde sagen, dass wir auch nicht alles einfach nur ins Netz verlagern können. Es verändert unseren historischen Gegenstand und es verändert damit dann auch das Gedenken. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich das noch ergänzen darf, dass die Pandemie vielleicht noch andere Auswirkungen haben könnte und dass bei diesem Thema möglicherweise die Pandemie uns sensibilisiert dafür, was eine Krise bedeutet. Nun ist sicherlich die Pandemie eine viel geringere Krise als Krieg und Besatzung, aber wir sehen in der Gegenwart, dass auch eine Krise wie die Pandemie in das, was wir als normal empfinden, eingreift und wir sehen, dass das etwas mit Gesellschaft macht.
Wie wünschen Sie sich, wie wir in Europa in ca. fünf Jahren über dieses Thema Besatzung nachdenken und sprechen?
Wir haben immer wieder gesagt, dass so etwas wie die Einigung Europas zunächst als westeuropäische Einigung vor dem Hintergrund der Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs zu sehen ist und ich glaube, dass das Ausmaß dessen etwas ist, was man tatsächlich in seinen großen Strukturen nutzen kann, um europäisch zu denken. Es bietet eine Chance zu sagen, das ist ein gemeinsames europäisches dunkles Erbe. Hedwig Richter hat in ihrem Buch über Demokratie als eine deutsche Affäre in Bezug auf Empathie und Mitleid gezeigt, wie das ein Teil von Demokratisierungsprozessen ist. Ich glaube, dass es auch hier im Kern um Empathie geht und es geht darum, zu sagen, auch diese Form von Empathie kann Auswirkung auf weitere Demokratisierungsprozesse haben. Ob wir das in fünf Jahren schon erreicht haben, weiß ich nicht, aber wenn, wäre es großartig.
Das war unser History and Politics Podcast mit Tatjana Tönsmeyer zum historischen, gesellschaftlichen und politischen Erbe nationalsozialistischer Besatzungsherrschaft in Europa.
Wenn Sie mehr zum Alltag unter deutscher Besatzung erfahren wollen, hören Sie gern in einen Vortrag zum Thema « Der große Hunger » von Tatjana Tönsmeyer hinein, der auf Deutschlandfunknova abrufbar ist. Oder freuen Sie sich auf ihr Buch, das unter dem Titel „Europa im Krieg - vom Leben unter deutscher Besatzung“ 2021 bzw. spätestens 2022 erscheinen wird
Alle weiteren Informationen zur Arbeit des Bereich Geschichte und Politik der Körber-Stiftung finden Sie auf unserer Stiftungswebsite. Dort gibt es natürlich auch alle Folgen unseres History and Politics Podcasts. Das war´s für heute, ich danke Ihnen für das Zuhören und hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn wir fragen, wie die Geschichte unsere Gegenwart prägt.

Geschichte ist Gegenwart! Der History & Politics Podcast der Körber-Stiftung
Warum Geschichte immer Gegenwart ist, besprechen wir mit unseren Gästen im History & Politics Podcast. Wir zeigen, wie uns die Geschichte hilft, die Gegenwart besser zu verstehen.
-
Is Globalization unstoppable? Insights from the Past#73 38 Min. 12. Jun 2024
-
Moldau: Perspektiven eines zerrissenen Landes#66 35 Min. 7. Mai 2024
-
The New Germany S03E06: Extremism: Defending Democracy in Past and Present#72 50 Min. 9. Apr 2024
-
Über die Geschichte einer gewaltfreien Gesellschaft#71 45 Min. 2. Apr 2024
-
The New Germany S03E05: Social Transformation: What is German?#70 53 Min. 26. Mrz 2024
-
The New Germany, S03E04: Made in Germany: Industry and Deindustrialisation#69 49 Min. 12. Mrz 2024
-
History in the Age of Disinformation#68 51 Min. 5. Mrz 2024
-
The New Germany, S03E03: Germany and the US: Cowboys and Keynesians#67 51 Min. 27. Feb 2024
-
Distance and emotion: Ukrainian historians in war times#65 53 Min. 20. Feb 2024
-
The New Germany, Season 3 - Episode 2: Germany and France: A Marriage on the Rocks#64 56 Min. 13. Feb 2024
-
The New Germany, Season 3 - Episode 1: Crisis Chancellors#63 55 Min. 30. Jan 2024
-
Technologien gegen das Vergessen#62 36 Min. 27. Jan 2024
-
Amerika – das Ende eines Traums?#61 64 Min. 12. Dez 2023
-
The New Germany, S02E07: Grenzen überwunden? Das Verhältnis zwischen Ost und West#60 84 Min. 14. Nov 2023
-
Zwischen Moral und Realpolitik: Das deutsch-israelische Verhältnis#59 46 Min. 12. Sep 2023
-
Chatting with the Past#58 47 Min. 8. Aug 2023
-
Die Arktis – Von der Friedenszone zur internationalen Konfliktzone#57 37 Min. 4. Jul 2023
-
Zeitenwende and the Return of History#56 44 Min. 8. Jun 2023
-
Polen und Europa seit 1989#55 33 Min. 30. Mai 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 6: German Politics in Flux#54 43 Min. 9. Mai 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 5: German Schuldenangst#53 46 Min. 25. Apr 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 4: Germany’s Grand Strategy#51 48 Min. 11. Apr 2023
-
Politik unter Einsatz des Körpers#52 42 Min. 6. Apr 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 3: Germany and Poland#49 47 Min. 28. Mrz 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 2: Germany and China#48 51 Min. 14. Mrz 2023
-
Das Jahr 1923 und German Schuldenangst#47 40 Min. 7. Mrz 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 1: Germany’s Russians#46 54 Min. 28. Feb 2023
-
Rechte Geschichtsbilder im Video-Gaming#45 47 Min. 15. Feb 2023
-
Asylpolitik: Eine Konfliktgeschichte#44 32 Min. 12. Jan 2023
-
Aktivist:innen in Russland: Zwischen Untergrund und Friedensnobelpreis#43 35 Min. 6. Dez 2022
-
Das Ringen um die neue Weltordnung#42 43 Min. 21. Nov 2022
-
Ukraine: Eine Nation unter Beschuss#41 45 Min. 21. Okt 2022
-
Wohnen – wo Privates politisch ist#40 32 Min. 6. Sep 2022
-
The New Germany, Part 4: The Lid of History#39 52 Min. 22. Aug 2022
-
The New Germany, Part 3: German Energy Policy and Russian Gas#38 43 Min. 8. Aug 2022
-
The New Germany, Part 2: A Love-Hate Relationship#36 57 Min. 25. Jul 2022
-
Russia: When History Becomes a Weapon (Englische Folge)#34 40 Min. 19. Jul 2022
-
The New Germany, Part 1: The Bundeswehr and Germany's Mindset#35 42 Min. 12. Jul 2022
-
Erinnerung hat Konfliktpotenzial – Wie sich unser Blick auf Geschichte ändert#33 48 Min. 7. Jun 2022
-
Krieg in der Ukraine: ein historischer Wendepunkt?#32 35 Min. 31. Mai 2022
-
Geschichte und Erinnerung in Games#31 28 Min. 3. Mai 2022
-
Belarus: Was bleibt von den Protesten 2020?#30 30 Min. 8. Mrz 2022
-
Sind Russland und China heute Imperien?#29 39 Min. 8. Feb 2022
-
#30PostSovietYears: Kann Kunst versöhnen?#28 39 Min. 30. Nov 2021
-
China – Modernisierung zwischen Isolation und Öffnung#27 39 Min. 28. Okt 2021
-
Deutschland und Polen - Geschichte und Zukunft einer guten Nachbarschaft#26 42 Min. 23. Sep 2021
-
Russland - Großmacht mit historisch gewachsenem Sonderstatus?#25 33 Min. 24. Jun 2021
-
Belarus – Über Proteste, Demokratie und Diaspora#24 39 Min. 29. Apr 2021
-
Die Vorgeschichte der Hohenzollern-Debatte. Adel, Nationalsozialismus und Mythenbildung nach 1945.#23 54 Min. 25. Mrz 2021
-
Jüdisches Leben in Deutschland seit 1945#20 50 Min. 25. Feb 2021
-
Deutschland und Frankreich – Fremde Freunde?#22 40 Min. 27. Jan 2021
-
Geschichtsvermittlung ist eine Zukunftsbranche#21 27 Min. 17. Dez 2020
-
Tatjana Tönsmeyer: Das europäische Erbe der NS-Besatzungsherrschaft#19 34 Min. 26. Nov 2020
-
Natasha A. Kelly: Rassismus und die Geschichte Schwarzer Menschen in Deutschland#18 40 Min. 19. Okt 2020
-
Sandra Günter: Sport macht Gesellschaft?#17 37 Min. 24. Sep 2020
-
Stefanie Middendorf: Geschichte der Staatsverschuldung: Kredite für die öffentliche Hand#16 40 Min. 27. Aug 2020
-
Helene von Bismarck: Großbritannien und die EU – ein historisches Missverständnis?#15 34 Min. 27. Jul 2020
-
Aleida Assmann: Was hält Europas Sterne zusammen?#14 24 Min. 25. Jun 2020
-
Birte Förster: Rolle rückwärts bei der Gleichberechtigung?#13 29 Min. 8. Jun 2020
-
Till van Rahden: Demokratie in Krisenzeiten#12 30 Min. 6. Mai 2020
-
Elke Gryglewski: Alles gesagt, alles gezeigt?#11 23 Min. 17. Apr 2020
-
Frank Uekoetter: Pandemien und Politik#10 25 Min. 27. Mrz 2020
-
Mary Elise Sarotte: Die NATO-Osterweiterung.#9 29 Min. 20. Nov 2019
-
Werner Plumpe: Die Kraft des Kapitalismus.#8 21 Min. 23. Okt 2019
-
Ilko-Sascha Kowalczuk: 30 Jahre Mauerfall – und nun?#7 23 Min. 1. Okt 2019
-
Claudia Weber: Kriegsausbruch 1939#6 24 Min. 11. Jul 2019
-
Jason Stanley: Faschismus damals und heute#5 18 Min. 4. Jul 2019
-
Philip Murphy: Rule Britannia?#4 24 Min. 27. Jun 2019
-
Hedwig Richter: Volksbegehren oder Staatsgewalt?#3 22 Min. 20. Jun 2019
-
David Ranan: Israelkritik und Antisemitismus#2 22 Min. 13. Jun 2019
-
Eckart Conze: Von Versailles 1919 zu den „Neuen Kriegen“#1 28 Min. 28. Mai 2019