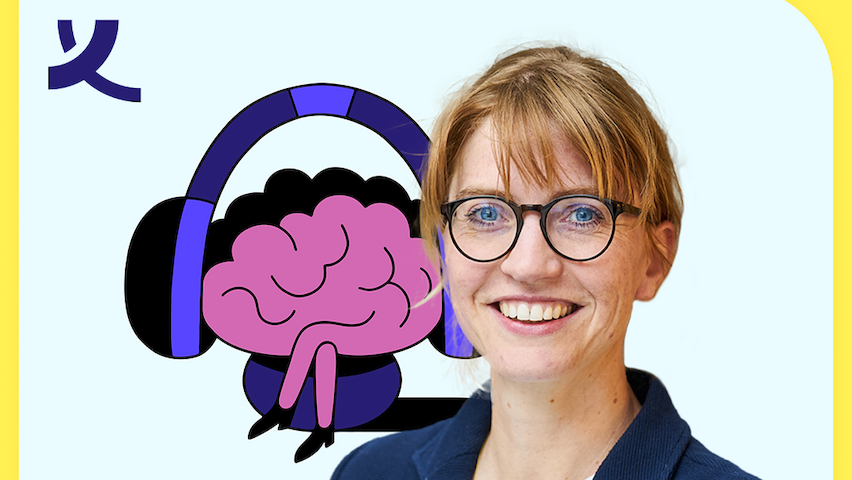Erinnerung hat Konfliktpotenzial – Wie sich unser Blick auf Geschichte ändert
Geschichte ist Gegenwart! Der History & Politics Podcast der Körber-Stiftung
Wie verändert sich unser Blick auf Geschichte und Erinnerung und welche Konflikte entstehen dabei? Wer bestimmt, wie Geschichte erzählt wird und welche Rolle spielen Emotionen dabei? Und können wir aus der Geschichte lernen? Darüber haben wir mit Historiker und Schriftsteller Per Leo gesprochen.
Das Manuskript zur Folge und weitere Informationen finden Sie auf unserer Podcast-Website.
Mehr über unser Programm eCommemoration erfahren Sie hier - Sie können eCommemoration auf Twitter folgen.
Weitere Informationen zu den Aktivitäten in unserem unserem Bereich Geschichte und Politik finden Sie auf unserem KoerberHistory-Twitter-Kanal.
„Nur ändert sich eben mit der Gesellschaft auch oft die Struktur der Konflikte. Konfliktlinien werden andere und mit diesen sich verändernden Konfliktlinien werden auch die Blicke auf die Vergangenheit anders. Andere Themen aus der Vergangenheit werden plötzlich zum Konfliktanlass.“
Per Leo, Historiker und Schriftsteller
Weiterführende Links und Informationen
Per Leo zum Lesen:
- Tränen ohne Trauer. Nach der Erinnerungskultur. Stuttgart, 2021.
- Mit Rechten reden. Ein Leitfaden (mit Maximilian Steinbeis und Daniel-Pascal Zorn). Stuttgart 2017.
- Über Nationalsozialismus sprechen. Ein Verkomplizierungsversuch. In: Merkur 70.5 (Mai 2016), S. 29–41.
- Flut und Boden. Roman einer Familie. Stuttgart 2014.
- Der Wille zum Wesen: Weltanschauungskultur, charakterologisches Denken und Judenfeindschaft in Deutschland 1890–1940. Berlin 2013 (Dissertation
Erwähnte Literaturauswahl zum Historikerstreit und den neuen Diskussionen:
- Der Historikerstreit war eine Debatte in den späten 1980er Jahren um die Singularität des Holocausts und die Frage, wie diese das deutsche Geschichtsbild prägt. Mehr zum Historikerstreit hier auf Wikipedia oder in Klaus Große Kracht (2010) Debatte: Der Historikerstreit, Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte.
- Einige Beiträge rund um die Diskussionen um deutsche Erinnerungskultur, die seit 2020 verstärkt geführt wird:
- Michael Rothberg (2009): Multidirectional Memory. Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization. , 2021 zunächst beim Metropol Verlag als “Multidirektionale Erinnerung” auf Deutsch erschienen, ebenfalls bei der bpb erhältlich (dort kann das PDF hier bei der bpb kostenfrei heruntergeladen werden).
Rezension zu Rothbergs Multidirektionale Erinnerung von Katharina Stengel bei H-Soz-Kult (11.5.2021).
Zusammenfassung der deutschen Debatte um Achille Mbembes Äußerungen um Erinnerungskultur bei Deutschlandfunk Kultur (19.5.2020).
Dirk Moses (2021): Der Katechismus der Deutschen, Geschichte der Gegenwart.
Saul Friedländer, Norbert Frei, Sybille Steinbacher, Dan Diner (2022) Ein Verbrechen ohne Namen. Anmerkungen zum neuen Streit über den Holocaust.
Weiterführende Links zu im Gespräch erwähnten Informationen und Diskussionen:
- Londoner Schuldenabkommen 1953
- Luxemburger Abkommen 1952 (Wiedergutmachungsabkommen/Reparations Agreement between Israel and West Germany)
- Jewish Claims Conference
- US Holocaust Memorial, Streit um das Konzept und die Definition des Holocaust-Begriffs in den 1970er Jahren
- Kritik am Berliner Holocaust Denkmal
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von History & Politics, dem Podcast der Körber-Stiftung zur Geschichte und Politik. Mein Name ist Gabriele Woidelko und ich leite in der Stiftung den Bereich Geschichte und Politik. Auch heute sprechen wir wieder mit einem Gast darüber, wie gesellschaftliche Veränderung die Perspektiven auf Geschichte prägen und welche Auswirkung das auf unser gesellschaftliches Erinnern hat, also wie die Geschichte die Gegenwart prägt.
Wie wir in Deutschland erinnern, wurde in den letzten Jahren intensiv diskutiert, vor allem mit Bezug auf den Nationalsozialismus und den Holocaust. Rund um die Gedenktage zum Ende des zweiten Weltkriegs wurde diese Diskussion in diesem Jahr besonders in Hinblick auf das Verhältnis zu Russland und zur Ukraine geführt. Dabei wird deutlich, dass sich unser Blick auf Geschichte verändert und dass wir unsere Deutung zunehmend hinterfragen. Wie also verändert sich unser Blick auf Geschichte und Erinnerung und welche Konflikte entstehen dabei? Wer bestimmt, welche Geschichte erzählt wird und welche Rolle spielen Emotionen? Können wir aus der Geschichte überhaupt lernen? Über diese Fragen hat meine Kollegin Fiona Fritz mit Per Leo gesprochen. Per Leo ist Historiker, Schriftsteller und Schatullenproduzent. Nachdem er 2013 seine Dissertation veröffentlichte, feierte er 2014 mit seinem Werk „Flut und Boden, Roman einer Familie“ sein literarisches Debüt. Er schreibt literarisch, essayistisch in diversen Zeitungen, Zeitschriften und Verlagen und 2021 hat er das Buch „Tränen ohne Trauer. Nach der Erinnerungskultur“ veröffentlicht. Wie immer haben wir für Sie liebe Zuhörerinnen und Zuhörer weiterführende Links zu Literatur, in der Podcast-Folge angesprochene Diskussionen und weitere Informationen in den Shownotes gesammelt. Diese Shownotes finden Sie in Ihrem Podcatcher oder natürlich auf unserer Website, da gibt es auch das Manuskript dieser Folge zum Nachlesen.
Fiona Fritz: Schön Herr Leo, dass Sie heute hier sind. Das freut mich sehr. Wir wollen heute über Zeitgeschichte, Erinnerungen und Erinnerungskultur sprechen. Das Programm, in dem ich hier bei der Körber-Stiftung arbeite, eCommemoration, geht es um digitale Erinnerungskultur - oder Geschichte und Erinnerung in digitalen Räumen, die Formulierung mag ich lieber -, und zwar auf Social Media, in Games oder Extended Reality. Die Grundannahme, die uns umtreibt, ist: neue Technologien, aber vor allem auch neue Generationen stellen neue Fragen an die Geschichte und rütteln so an bestehenden Herangehensweisen und Annahmen und führen vielleicht auch dazu, dass viele Dinge noch mal kritisch hinterfragt werden. Das war gerade in den letzten Jahren immer wieder ein ganz heikles Thema, ein ganz heiß diskutiertes Thema: wie schauen wir auf die deutsche Geschichte vor allem als Deutsche oder in Deutschland und wie gehen wir mit unserer Geschichte um? Da wollte ich einfach mal ganz frech fragen, ob Sie ein bisschen skizzieren können, wo aus Ihrer Sicht die großen Konfliktlinien sind.
Per Leo: Das ist wirklich sehr groß gefragt. Ich würde die Sache ein bisschen tiefer hängen und erst mal feststellen wollen, dass nicht nur Geschichte selbst permanenten Wandel bedeutet, sondern auch der Blick auf die Vergangenheit, sei es in der Geschichtswissenschaft, sei es in Gedenkritualen, sei es aber auch im persönlichen Verhältnis, also dem, was man im engeren Sinne Erinnerung nennen kann. Jeder kennt aus der persönlichen Erfahrung, dass sich der Blick auf die eigene Vergangenheit, auf das eigene Leben, mit der Zeit ändert. Man guckt auf die Jugend, das ist fast ein Klischee, aber es trifft oft auch zu, mit zunehmendem Altern immer rosiger. Man hat die Tendenz, bestimmte Vergangenheiten zu idealisieren, während die Zeiten, wenn sie einem noch nahe sind, vielleicht auch noch viel deutlicher spürbar sind, doch ambivalenter waren oder es unterschiedliche Gefühlslagen miteinander vermischt waren. Ich will an diesem persönlichen Beispiel nur klar machen, dass nicht nur Zeiten, also das was wir Geschichte nennen, sich verändert, sondern auch unser Blick auf die Vergangenheit. Das gilt auch für Gesellschaften. Anders als bei Individuen kann man da nicht davon sprechen, dass es sich um eine Erinnerung, eine Vergangenheit oder einen Blick handelt, sondern es sind immer verschiedene Blicke, die schon konflikthaft aufeinander bezogen sind. Daran ist erst mal nichts neu. Nur ändert sich mit der Gesellschaft auch oft die Struktur der Konflikte. Die Konfliktlinien werden andere und mit diesen sich verändernden Konfliktlinien werden auch die Blicke auf die Vergangenheit anders. Andere Themen aus der Vergangenheit werden plötzlich zum Konfliktanlass.
Nehmen Sie eine besonders heiße Phase in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus Mitte der 80er Jahre, den Historikerstreit. Da kulminiert etwas, das ist nicht nur ein kurzer Streit, der ein paar Monate dauert, der einen konkreten Anfang und Ende hat, sondern da verdichtet sich etwas, was lange umstritten ist. Es geht um die Frage, inwiefern Deutschland ein normaler Nationalstaat werden soll, der sich nicht mehr nur oder in erster Linie über eine negative Vergangenheit oder die Abgrenzung von einer als mit guten Gründen negativ empfundene Vergangenheit definieren soll. Oder, das wäre die Alternative, inwiefern diese negative Vergangenheit tatsächlich dauerhaft zu einem Kernbestand deutscher Identität, politischer Kultur gehören soll. Das ist eine umstrittene Frage, die unter Stichworten wie „Schlussstrichforderung“ und so weiter oft zusammengezogen wird. Es ist eine elementare Frage, die, nachdem die Bundesrepublik die Rechtsnachfolge bekanntlich angetreten hat, ganz handfeste politische Probleme mit sich bringt. Das Londoner Schuldenabkommen zum Beispiel oder das Luxemburger Abkommen, in dem die sogenannten Wiedergutmachungszahlung an Israel und die Jewish Claims Conference gezahlt wurden, waren ganz handfeste politische Fragen, die aufgearbeitet oder bewältigt werden mussten. Mitte der 80er Jahre ist das etwas anders, da sind diese handfesten Fragen weitgehend erledigt. Es steht aber die kulturelle gesellschaftliche Frage im Raum, was bleibt, wenn wir nicht mehr unbedingt müssen? Das ist eine unbeantwortete Frage, die zum Konflikt führt und dieser Konflikt führt in den 80er Jahren zu einem Ergebnis. Dieses Ergebnis lautet damals, bei allem was ich im Einzelnen kritisieren würde, rückblickend mit guten Gründen, diese Vergangenheit soll nicht vergehen.
Unsere Lage heute ist eine andere. Das bedeutet nicht, dass alles, was damals umkämpft war und zu Zwischenergebnissen geführt hat, heute Makulatur ist. Unsere Konfliktlinien, unsere gesellschaftliche Struktur haben sich zum Beispiel dahin geändert, dass wir in viel stärkerem Maße, um nur eine Dimension zu nennen, eine Einwanderungsgesellschaft geworden sind. Das waren wir damals faktisch auch schon, unserem Selbstverständnis nach aber überhaupt nicht. Das heißt, die Debatten damals, zum Beispiel der Historikerstreik, wurden von Ethnodeutsche, zum großen Teil auch Kriegsteilnehmer oder zumindest im NS oder im Krieg geborene, aufgewachsene, also Zeitgenossen, die auf ihr eigenes Leben zurückblickten, geführt. Es war eine komplett innerdeutsche, auch im ethnischen Sinne, Debatte, die von genau den Leuten geführt wurde, die aus dem NS herauskamen. Die Einwanderer, die damals schon bei uns waren, spielten als gesellschaftliche Stimme überhaupt keine Rolle, das waren bestenfalls Arbeitskräfte. Das hat sich heute dramatisch geändert, nicht nur quantitativ, auch qualitativ, was die Heterogenität der Einwanderergruppen angeht, glücklicherweise auch dem Selbstverständnis nach, sowohl der migrantischen Gruppen als auch der Mehrheitsgesellschaft, die sagen, unsere Gesellschaft ist heute eine diverse, das mag man mögen oder nicht, aber das ist einfach eine soziale Tatsache. In dem Maße, wie sich die Stimmen, die am gesellschaftlichen und politischen Diskurs teilnehmen, vervielfältigt haben, vervielfältigen sich ganz selbstverständlich auch die Blicke auf die Geschichte. Das ist nicht leicht zu sagen, weil diese Geschichte ist nicht mehr nur umkämpft durch zwei idealtypische Gruppen, die diese Geschichte gemeinsam erlebt, erlitten und zu verantworten haben und jetzt aber gegensätzliche Standpunkte einnehmen. Sondern das sind Gruppen, die teilweise auf ganz andere Vergangenheiten zurückblicken, sowohl was ihre Herkunftsländer betrifft als auch was ihr eigenes Erleben und ihre eigene Biografie in Deutschland betrifft. Das ist nur eine grobe Skizze, aber ganz selbstverständlich gehen damit Blicke auf die Vergangenheit einher, die nicht mehr aufgehen in den Perspektiven, die sich zum Beispiel in den 80er Jahren letztlich prägend und stilbildend entwickelt haben.
Die Debatte in den 80er Jahren war auch eine, die sehr intensiv in Deutschland geführt wurde. In der Debatte jetzt schalten sich zunehmend nichtdeutsche Stimmen ein, aus Australien, den USA, mit ganz anderen Perspektiven, in vielen anderen englischsprachigen Ländern ist „Holocaust and Genocide Studies“ ein Begriff, dass da mehrere Genozide erforscht werden können. Wie schätzen Sie das ein, wie diese internationale Perspektive die deutsche Wissenschaftsdebatte, aber auch die gesellschaftlich breiter geführte Debatte prägt?
Das ist eine zutreffende Beobachtung, wobei man den Unterschied nicht zu stark machen sollte. Sie haben völlig zurecht gesagt, dass die Debatten, zum Beispiel der sogenannte Historikerstreit 2.0, ich weiß nicht, ob das glücklich gewählt ist, aber lassen wir es als Name stehen, nicht nur geprägt, sondern zu guten Teilen auch initiiert wurde von nichtdeutschen Akteuren. Die Debatte wird seit etwa zwei, zweieinhalb Jahren in Deutschland geführt, insbesondere um das Verhältnis, sagen wir mal, von NS-Verbrechen und kolonialer Vergangenheit, Kolonialverbrechen, um es mit Stichworten zu sagen. Um ein paar Namen zu nennen, Achille Mbembe, Michael Roßberg aus Amerika, Dirk Moses aus Australien. Das ist absolut richtig und die deutsche Debatte besteht in vielen Beiträgen tatsächlich in erster Linie in Reaktionen, oft in harschen Abwehrreaktionen, die nicht Kritik übt oder Position und Gegenposition nutzt, sondern was Abwehrendes hat. Andererseits sollte man nicht unterschätzen, inwieweit die Debatte, die in den 80er Jahren in Deutschland geführt wird, auch internationale Dimensionen hat. Nicht wie heute mit Stichwortgeber von außen, sondern von den Themen, die damals behandelt wurden. Zum Beispiel die Frage nach der Singularität des Holocaust oder überhaupt die Frage, wie erinnern wir, wie gedenken wir des Holocaust, wer gedenkt und gibt es da Unterschiede? Ist, um ein Beispiel zu nennen, die Erinnerung an den Holocaust ein universales Erbe der Menschheit oder ist es ein spezifisches Erbe bestimmter Gruppen? Gibt es für beide Positionen gute Argumente? Selbstverständlich spielt für die Juden in aller Welt und insbesondere auch für den Staat Israel die Erinnerung an den Holocaust eine ganz besondere Rolle. Genauso besonders, noch viel komplizierter, ist es im deutschen Fall. Man könnte Amerika noch hinzunehmen als das Land mit der zweitgrößten jüdischen Gemeinde oder quantitativ zweitgrößten jüdischen Leben nach Israel. Die andere Position, die sagt, das Verbrechen, das dort begangen wurde, hat tatsächlich universale Dimensionen, weswegen es auch universal erinnert werden sollte, hat auch sehr viel für sich.
Ich will gar nicht in diese Debatte einsteigen. Es ist aber eine, die in dieser Zeit geführt wird und in Deutschland werden viele Stichworte aufgegriffen, die zum Beispiel in inneramerikanischen und auch innerjüdischen Diskursen vorgeprägt wurden. Das große Schlagwort des „nie wieder“, was auch die deutschen Debatten der alten Bundesrepublik am Ende hin stark betont hat und zu dem führten, was wir heute Erinnerungskultur nennen. Dieser präventive Gedanke, dass wir, um Verbrechen, Menschheitsverbrechen in der Zukunft vorbeugen zu können, zur Voraussetzung hat, dass wir uns der vergangenen Verbrechen erinnern. Das ist ein hochvoraussetzungsreicher, hochproblematischer, aus meiner Sicht auch kritikwürdiger Gedanke, der erst mal da ist, aber nicht in Deutschland, sondern in den USA geprägt wird. Das viel zitierte „nie wieder“ hat seine Urform im US-Holocaust Memorial, das zwar 1993 erst eröffnet wurde, aber 1978 initiiert wurde. Zu dieser Zeit hält der amerikanische Präsident Jimmy Carter eine denkwürdige Rede, in der dieses „never again“ im Namen eines Menschenrechtsidealismus rückgekoppelt wird an die Erinnerung an den Holocaust. Da geht es schon los, was ist mit Holocaust gemeint? Das ist auch eine hochumstrittene Frage.
Absolut, ja.
Dieser Frage sind wir uns heute nicht mehr bewusst, weil es sich im Sprachgebrauch selbstverständlich eingebürgert hat, darunter die Ermordung der europäischen Juden zu verstehen. Im amerikanischen Diskurs und insbesondere auch in dem von Jimmy Carter initiierten Gedenkprojekt steht der Holocaust aber für alle zivilen Opfer des NS. Das wird dann symbolisch in die Zahl elf Millionen, die faktisch nicht gedeckt ist, aber ausdrückt, es geht um sechs Millionen plus X, in dem Fall fünf. Da sieht man schon, dass das Debatten sind, die hochkomplizierte Fragen behandeln, die aber gut zehn Jahre bevor in Deutschland der Historikerstreit geführt wird, bereits in den Vereinigten Staaten Thema sind. Was ich sagen will, auch die Debatten der 80er Jahre haben eine internationale Dimension. Sie werden nur innerhalb der nationalen Gesellschaften abgeschotteter geführt. Heute haben wir eine Weltgesellschaft, wo es sehr viel selbstverständlicher ist, dass ein Genozid-Forscher aus Australien hier einen kurzen Essay platziert und die deutsche Öffentlichkeit dreht sich im Kreis. Das ist wahrscheinlich einem medialen Wandel, den man unter dem Schlagwort Globalisierung fassen könnte, geschuldet. Auch die 80er Jahre hatten schon internationale Dimensionen.
Das finde ich spannend, gerade der Aspekt der Vernetzung, immer mehr erfahren wir aus anderen Ländern, über deren Diskussionen, über deren gesellschaftliche Strömungen, die neu aufkommen. Ich finde spannend zu beobachten, dass das in den 80er Jahren oder vor den 80er Jahren auch schon war, aber isolierter geführt wurde. Mich würde interessieren, sehen Sie einen Vorteil oder welche Vorteile sehen Sie, wenn wir internationale oder transnationale Diskussionen führen oder sogar auf Geschichte blicken. Sagen Sie, dass ist eine notwendige Voraussetzung, dass mehrere Länder, mehrere Regionen miteinander diskutieren?
Ich komme gleich drauf, nur eine Ergänzung. Ich habe gerade Globalisierung allgemein gesagt, aber selbstverständlich ist der entscheidende mediale Wandel, das Medium, über das transportiert wird, das Internet. Die sozialen Medien machen es möglich. Bevor früher ein Diskussionsbeitrag in der New York Times in Deutschland rezipierbar wurde, hätte er übersetzt oder zumindest gelesen und zitiert werden müssen. Das haben Sie heute in den sozialen Medien nicht mehr. Das heißt, bevor Dirk Moses eine Debatte auslöst, müssen nur ein paar Sekunden vergangen sein, weil es ein Tweet ist, der darauf aufmerksam macht und dann ist eher das Problem, wie hegen Sie diese Erregung wieder ein. Diese globale Dimension hat mit Twitter, Facebook und so weiter zu tun. Im deutschen Fall tut uns die Internationalisierung der Debatte sehr gut. Das wäre ein Kritikpunkt, den ich gegenwärtig an deutschen Befindlichkeiten oder deutschen Debattenlagen habe. Die Idee, dass es ein Thema sei, das vor allem die Deutschen mit sich selbst ausmachen müssten. Das kann man zerknirscht feststellen, man kann aber auch oft mit teilweise unangemessenem Stolz feststellen, dass wir es richtig gemacht haben und uns bitte niemand von außen sagen soll, wie wir mit unserer Vergangenheit umzugehen haben. Da kann man sagen, Moment, wer hat es erfunden. In vielem waren es eben nicht wir Deutschen. Dieser zugespitzt gesagt Provinzialismus gehört aufgeschreckt. Bei allem, was ich punktuell an Beispielen wie Dirk Moses, Mbembe oder Roßberg kritisieren würde, ist die Einmischung von außen etwas sehr Willkommenes und sollte uns zeigen, dass die Themen, die verhandelt werden, keine reinen deutschen sind. In einer sich verändernden Welt, die immer globaler wird, täten wir gut daran, wenn sich unsere Perspektiven auf die Welt und auch die erinnerungspolitischen globalisieren würden. Insofern, ist alles, was uns aus diesem nationalstaatlichen Container rausbringt, der damals durchaus sein Gutes hatte, erstmal willkommen.
In der Vorbereitung habe ich mir überlegt, wer sind die Protagonisten, wer sind die Antagonisten und habe immer den Eindruck, dass in der Diskussion manche Positionen zu Antagonisten gemacht werden, die gar keine Antagonisten sind. Alle sagen im Prinzip, das „nie wieder“ steht nicht zur Debatte und wir wollen nur genauer hingucken. Andere Perspektiven und die Antagonisten, die wirklich den Holocaust in der NS-Zeit verharmlosen oder leugnen, stehen am Rand und können zugucken, wie sich die anderen zerfleischen.
Das ist eine gute Beobachtung, die ich auch teilen würde. Das kann man auch daran sehen, dass oftmals auf ein und dieselbe Position in einem Fall höchst erregt reagiert wurde und im anderen Fall nicht mehr ganz so erregt. Das kann man an meinem Beispiel ganz gut feststellen. Ich habe für mein letztes Buch scharfe Kritik bekommen. Das Interessante ist, dass ich, wenn ich die gesamte Rezeption meines Buchs und meiner folgenden Auftritte zusammenfassen sollte, würde ich sagen, die ist erfreulich differenziert. Da gibt es die gesamte Bandbreite von scharfer Kritik bis enthusiastische Zustimmung, Differenzierung, schlauere Lektüren, weniger schlaue, differenzierte, aber es ist alles da. Da ich in Strecken auch ein polemisches Buch geschrieben habe, habe ich eine ziemlich gute Diskussion bekommen. Wenn Sie die genannten drei Namen, Mbembe, Roßberg, Moses nehmen, sind die auf teilweise heftige, einhellige, harsche Ablehnung gestoßen. Nicht in der Art, da ist ein Punkt, den wir kritisieren müssen, das siehst du von außen vielleicht falsch oder das ist anregend, das ist simplifizierend, wie auch immer. Diese Art von Diskussion war es nicht, da habe ich mich mit Dirk Moses länger drüber unterhalten. Es ist sehr interessant, dass wir in bestimmten einzelnen Punkten ganz ähnliche Kritik üben. Über ihn wurden kübelweise Ablehnung ausgeschüttet. Das betrifft nicht den Umstand, dass man einiges an ihm kritisieren kann, sondern die Heftigkeit, die Art und Weise und die pauschale Qualität der Ablehnung. Während ich sagen muss, genau diese Art von pauschaler Ablehnung habe ich nicht erfahren. Ich glaube, dass hat mit einem Standortvorteil als ein deutscher Sprecher in Deutschland zu tun. Das ist einer von uns, wir sehen zwar nicht alles so wie er sagt, aber das können wir unter uns klären. Ich wurde nicht als Störenfried wahrgenommen, das ist sehr interessant. Das bestätigt Ihre Vermutung, dass es in erster Linie nicht diametral entgegengesetzte Positionen, wie Sie sagten, Protagonist und Antagonist, sind. In den 80er Jahre stand Normalisierung, Revisionismus versus fortlaufende Selbstkritik, das sind gegensätzliche Positionen. Das ist hier nicht der Fall. Wenn Sie genau hingucken, ist es aber auch ein Internetphänomen. Immer wieder erstaunlich, wie sehr Fragen, die durchaus umstritten sein können, zu Lagerbildung führen, die dem Konfliktpotenzial dieser konkreten Frage oft gar nicht angemessen sind. Ich bestätige, was Sie sagen und würde mich freuen, wenn es gelänge, den Unterschied wieder etwas deutlicher zu sehen, zwischen dem, wo wir uns klar positionieren müssen und dem, wo wir sagen müssen, es gibt aus guten Gründen unterschiedliche Meinungen und die müssen wir auch diskutieren, weil es Klärungsbedarf gibt.
Sie haben gerade schon Ihr Buch angesprochen. Tränen ohne Trauer, nach der Erinnerungskultur. Ich würde gerne zu dem Untertitel fragen. Wir haben jetzt über die wissenschaftlichen Diskussionen gesprochen, aber Erinnerungskultur deutet ja an, dass die Gesellschaft auch irgendwie involviert ist. Was hat Sie dazu bewegt zu sagen, nach der Erinnerungskultur und was meinen Sie damit?
Damit kann ich ein Motiv aufgreifen, das ich ganz am Anfang unseres Gespräches schon angestimmt habe. Der Umstand, dass sich unser Blick auf die Vergangenheit ändert. Das ist erst mal nicht so spektakulär. Nur hat die jeweilige Gegenwart immer die Tendenz, diesen Blick in die Zukunft auf ewig zu transponieren, weil das einem gerade so plausibel vorkommt. Der Historiker weiß aber, das, was uns heute selbstverständlich vorkommt, wird in ein paar Jahren nicht mehr so selbstverständlich sein und manches davon zeichnet sich deutlicher ab als anderes. Das, was wir heute Erinnerungskultur nennen, befindet sich in einer Krise und wird, das ist für mich evident, schon in ein paar Jahren Vergangenheit sein. Wir können das noch ein bisschen konkretisieren. Ich würde sogar sagen, mit dem Ukraine-Krieg ist das passé.
Ja.
Das ist eine ganz starke Zäsur, die aus meiner Sicht nur Tendenzen deutlich konturiert sichtbar macht, die schon lange bestehen. Der Untertitel „nach der Erinnerungskultur“ ist nicht als Schlussstrich, im Sinne des Historikerstreits oder der damals geführten Debatten Normalisierung, gemeint, sondern im Sinne des Wandels. Wir haben unterschiedliche Schlagwörter, unter denen die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit, sowohl in der Bundesrepublik, wie auch in der DDR geführt wurde. Ich zähle ein paar auf, das kommt in dem Buch auch vor, aber nehmen wir mal Entnazifizierung, Antifaschismus, Aufarbeitung der Vergangenheit, Bewältigung der Vergangenheit. Das Schlagwort, unter dem das gegenwärtig meistens läuft, ist Erinnerungskultur. Dafür gibt es gute Gründe, das ist aus bestimmten Umständen heraus entstanden. Ich würde aber sagen, diese Umstände haben sich so gewandelt, dass mittlerweile die dysfunktionalen Elemente und die Probleme der Erinnerungskultur immer deutlicher hervortreten und wir uns fragen müssen, ob es nicht Zeit ist, etwas anders auf diese Zeit zu blicken, nach wie vor in kritischer, selbstkritischer Auseinandersetzung, aber anders.
Ich habe mich gerade gefragt, wie verschiedene gesellschaftliche Ebenen unterschiedliche Rollen spielen. Einerseits die Wissenschaft, aber auch der Politikbetrieb. Wenn ich an Erinnerungskultur denke, was das bedeutet, dann stelle ich mir vor, ich überspitze das jetzt, ein alter weißer Mann legt irgendwo einen Kranz nieder. Das ist alles sehr würdevoll und sicherlich auch wichtige Gedenkmomente, aber ich habe oft den Eindruck, wo findet das in der Gesellschaft statt? Ist das nur in der Schule, wo das thematisiert wird, wo dann auch der eine oder andere mit den Augen rollt – „noch mal ein Nazibuch“. Gerade in der Beschäftigung mit digitalen Spielen und den digitalen Medien, ist das so präsent, dass ich den Eindruck habe, das Thema spielt auch für eine breitere Gesellschaft noch eine Rolle. Ich finde noch schwer zu greifen, wie das zur „Erinnerungskultur“ passt.
Wie gesagt, da würde ich im Sinne meiner Kritik sagen, es ist gar nicht sinnvoll, das alles unter dem Begriff Erinnerungskultur zusammenzufassen. Man kann auf vielen Ebenen die Kritik ansetzen, schon bei dem Begriff der Erinnerung. Erinnerung ist, wenn man es streng nimmt, immer etwas Persönliches, schon der Begriff der kollektiven Erinnerung ist hochproblematisch. Wenn man ihn genau nimmt, können wir sagen, es gibt kollektive kulturelle Formen, Grenzen des Sagbaren, die politisch und kulturell ausgehandelt werden und geformt werden. Genau genommen sind das aber immer nur Bedingungen von Erinnerung. Damit werden Rahmen, wird eine Sprache für mögliche Erinnerung gestiftet. Genau da kann man wiederum sagen, die persönliche Erinnerung kann dazu oft quer stehen. Die kann sich dadurch auszeichnen, dass sie sich nicht in diese vorgefassten Formen fügen lässt. Um ein Beispiel zu nennen, deutsche Kriegsteilnehmer aus dem zweiten Weltkrieg, die am Ende aus Ostpreußen vertrieben wurden, die auf dieser Flucht Angehörige, Kinder verloren haben, die von sowjetischen Soldaten vergewaltigt wurden, haben selbstverständlich ein Anrecht, eine Würde geradezu, sich dieser traumatischen Erinnerungen des eigenen Opferseins, des eigenen Leids zu erinnern. Es besteht eine gewisse Tragik darin, dass diese persönlichen Erinnerungen in Deutschland niemals Formen gefunden haben, dem auch kulturell und politisch gerecht zu werden. Das ist nicht nur ein Versäumnis, sondern das hat Gründe, weil genau diese traumatischen Erinnerungen sehr schnell von Interessengruppen politisiert wurden. Sodass man sagen konnte, es war gar nicht möglich, der deutschen Bombenopfer oder der deutschen Vertreibungsopfer zu gedenken. In dem Moment, in dem man es hätte tun wollen, die Interessengruppen, die das im Sinne eines politischen Revisionismus, wenn nicht gar eines rechtsextremen Blicks auf die eigene Geschichte, schon längst getan hatten. Ich will an diesem Beispiel klar machen, dass die kulturellen Formen, in denen gedacht wird, erst mal nicht das gleiche sind wie Erinnerungen. Man kann schon beim Begriff der Erinnerungskultur ansetzen und sagen, das ist alles Kokolores, gibt es nicht.
Was Sie gerade ansprechen sind zwei Sachen. Das eine, die alten weißen Männer, die Reden halten und Kränze abwerfen, präzise bezeichnet Gedenkveranstaltungen. Die haben ihr gutes Recht und sind oft furchtbar langweilig und bräsig, aber sie sind es eben im gleichen Sinne wie auch die meisten Predigten langweilig und bräsig sind. Sie haben einen immer wiederkehrenden Anlass, zu dem einer bestimmten Sache, sei es jetzt religiös, politisch oder zivilreligiös, gedacht wird. Da gilt, das habe ich auch an anderer Stelle gesagt, für Gedenkveranstaltungen nichts anderes als für die Predigt. Nur weil sie jeden Sonntag gehalten werden muss und oft langweilig gehalten wird, heißt es nicht, dass man den Anlass nicht nutzen kann, um etwas Überraschendes, etwas Neues, etwas Anregendes, Tröstliches, Erbauliches, was auch immer zu sagen. Genauso ist es mit den Gedenkveranstaltungen. Wenn wir es präziser fassen, statt diesen Waberbegriffs „Erinnerung“, der unpräzise ist, gibt es das Gedenken. Das ist eine bestimmte Art, sich als politisches Gemeinwesen, meinetwegen auch zivilreligiös konnotiert, der eigenen Vergangenheit nicht zu erinnern, sondern sie zu vergegenwärtigen. Bei Computerspielen hat das mit Gedenken oder auch erinnern nichts zu tun, es hat damit zu tun, dass es im Sinne des Nachlebens ein glühender, nach wie vor lebendiger Stoff ist. Es ist ein historischer Stoff, der alles andere als tot ist und der ständig überall in unterschiedlichsten Formen thematisiert wird. Diese Vielfalt, würde ich sagen, muss man erst mal gar nicht unter einen Begriff binden, es sei denn so ein großer Überbegriff wie Nachleben oder eben Stoff.
Wie schätzen Sie ein, welche Rolle die Frage von Zeitzeug:innen spielt, insbesondere die traurige Tatsache, dass das aus dieser Erlebnisgeneration, Erzählgeneration, immer weniger werden. Was kommt, wenn dieser persönliche Bezug fehlt?
Das ist ganz entscheidend, aber mir geht es in erster Linie nicht um die Zeitzeugenschaft. Noch bevor man die feststellt, kann man sagen, dass für die Menschen, all das, worüber wir gerade sprechen, dieses große historische Geschehen, kein Stoff, sondern Erfahrungen sind. Das ist ihr Leben, das ist ein Teil ihres Lebens. Da ist es zunächst völlig egal, ob Sie auf der Täter- oder auf der Opferseite stehen, es ist Ihr Leben. Bei so Totalgeschehen, wie es dieser große europäische Krieg gewesen ist, betrifft es jeden. Bevor sie Zeitzeugen werden, sind diese Menschen also erst mal Zeitgenossen, die ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben, die dann zu Erinnerungen gerinnen. Das sind unsere Eltern, unsere Großeltern, unsere Urgroßeltern. Das heißt, dass allein durch ihr Leben unter uns, als Nachbar, als Freunde, als Kollegen, aber vor allem als Familienmitglieder, ist diese Geschichte auch unter uns. Das ist etwas, was Sie und ich vermutlich auch in unseren Familien ständig erlebt haben. Ich habe unglaubliche berufliche Inspiration daraus gezogen. Dass ich zum NS-Historiker und Schriftsteller wurde, hat mit der Präsenz und dem Leben, nicht dem Nachleben, dieses historischen Geschehens in meinem Nahfeld zu tun. Was man daraus macht, ist erst mal zweitrangig. Man kann sich dem auch verweigern, aber allein, dass man es tut, zeigt, man muss sich dazu verhalten. Dieser ganz fundamentale Umstand ist mit dem Aussterben der Zeitgenossen futsch. Die letzten Zeitgenossen sterben aus, es sind heute nur noch Solitäre. Es wird in ein paar Jahren keinen einzigen Menschen mehr geben, der das unmittelbar selbst erlebt hat. Primär wären die Erfahrungen der Zeitgenossen. Auch die Begegnung mit den Zeitgenossen, das ist dann aber auch schon die sekundäre Dimension, fällt komplett weg. Das heißt, es gibt gar nichts anderes mehr als die sekundären Formen, die das angenommen hat. Die kulturellen Formen, ebenfalls sekundär, sind jetzt das Primäre und das kann man als Zäsur, glaube ich, gar nicht überschätzen. Ich würde noch mal sagen, die Zäsur betrifft nicht die Zeitzeugen, die sind schon sekundär, sondern die Zeitgenossen. Die Erfahrung lebt nicht mehr unter uns.
Welche Bedeutungen spielen Emotionen in Bezug auf Geschichte erinnern, vor allem in diesem Spannungsfeld zwischen ganz individuellen Emotionen, wie Trauer, aber vielleicht auch Scham und Betroffenheit und „nationale Emotion“, wie Kränkung, nationale Kränkung, Nationalstolz?
Erst mal würde ich sagen, der Begriff der Emotion teilt eine Dimension mit dem Begriff der Erinnerung. Wenn man ihn sinnvoll verwenden will, kann man immer nur von individueller Erinnerung oder von individuellen Gefühlen sprechen. Man kann noch sinnvoll davon sprechen, dass es bestimmte Ereignisse gibt, die Menschen so stark verbinden, ein Geschehen, das so stark ist, dass man davon ausgehen kann, dass zwar jeder für sich selbst empfindet oder sich erinnert, aber weil es gemeinsam stattgefunden hat, erinnert man sich auch gemeinsam Trotzdem bleibt streng genommen das Gemeinsame immer eine Abstraktion, es bleibt individuell. Man muss nicht bis zum zweiten Weltkrieg zurückgehen. Wenn Sie in einer Fankurve beim Fußballspiel stehen und Ihre Mannschaft schießt nach einem 0:2 Rückstand in der letzten Minute das Siegtor und der Abstieg wird verhindert oder die Meisterschaft gesichert, dann können Sie davon ausgehen, dass in dem Moment ein starkes gemeinsames Erleben stattfindet. Das was Sie ansprechen, also die Frage, ob es so was wie nationale Emotion gibt. Ich würde sagen, es gibt sie nicht. Es gibt aber bestimmte Ereigniszusammenhängen, wie zum Beispiel Krieg, in der Sie bestimmte Erfahrungen mit einer großen Zahl von Menschen teilen. Da geht es um die Frage, ob auf Sie geschossen wird oder ob Sie schießen, ob Sie am Ende unterliegen oder selbst Hegemon eines Kontinents werden. Es gibt sicherlich etwas wie ein ukrainisches Nationalgefühl derzeit. Die Frage der Kränkung ist viel schwieriger.
Jedenfalls hat all das, worüber wir hier reden, eine ganz stark emotionale Dimension und es wäre geradezu ein Akt der Aufklärung, diese Dimension anzusprechen. Nicht, wie man voreilig meinen könnte, indem man die Emotionen ruhen und den Kopf sprechen lässt, das ist oft das Gegenteil von Aufklärung. Aufklärung würde bedeuten, das, was ist, zu klären und zu benennen und Begriffe dafür zu finden und zu erklären. Das ist ein Punkt, an dem unser Umgang mit dieser Vergangenheit oft krankt. Die nicht zu leugnende und gut erklärbare emotionale Dimension wird oft nicht thematisiert Vieles von dem, was Leute auseinanderbringt, gegeneinander aufbringt, in Erregung versetzt, hat eine stark affektive Grundlage. Ich glaube, wenn man diese Grundlage benennen würde und auch, warum Ihre Grundlage eine andere ist als meine, ließen sich bestimmte Konflikte dadurch entschärfen, dass man sieht, da ist etwas, was sich nicht komplett konfliktfrei auflösen lässt.
Vielleicht auch, als Grundvoraussetzung, indem man bei sich selbst nicht den Anspruch hat, hier gibt es eine richtige Meinung und alles andere ist falsch.
Richtig. aber genau das legen Emotionen uns nahe. Sie leben von ihrer Eindeutigkeit, aber das kann man auflösen, indem man sich zu seinem Gefühl verhält.
Genau. Mich bringt das zu der Frage, wie konstruieren wir Geschichte und die Vergangenheit, wie sprechen wir darüber, wie schreiben wir darüber? Sie haben, ich würde sagen, drei verschiedene Typen, Sachbuch, Dissertation, aber auch einen Roman verfasst. Wie ist das für Sie persönlich, sich in diesen unterschiedlichen Texttypen, aber auch auf unterschiedliche Arten und Weisen mit sehr ähnlichen Themen oder mit dem gleichen Thema auseinanderzusetzen?
Wir können auf den Anfangsbegriff zurückkommen. Das ist ein Stoff, der sich verschiedene Ausdrucksformen gesucht hat. Dass ich mich wissenschaftlich, literarisch, publizistisch, essayistisch mit dem Stoff beschäftigt habe, ist viel weniger souverän, als es klingt, sondern das ist so passiert. Das Einzige, was ich zugelassen habe, ist die Einsicht, dass, nicht die theoretische, sondern die praktische Einsicht, dieser Stoff in einem Maße lebendig ist, dass es mit der wissenschaftlichen Bearbeitung allein nicht getan ist, es bleibt, es muss ein Rückstand blieben. Wissenschaft verträgt sich nicht mit Emotionalität, mit starker persönlicher Involviertheit. Sie haben als Historiker in der Regel einen persönlichen, vielleicht sogar biografischen Hintergrund für die Themen, die Sie sich suchen. Den müssen Sie so klein wie möglich halten. In meiner Dissertation habe ich ihn nur anekdotisch am Anfang erwähnt, aber nicht, um zu sagen, so fühle ich, da komme ich her, sondern es gibt ein autobiografisches Moment, in dem sich szenisch ein wissenschaftliches Problem anschaulich zeigen lässt. Die Metapher, die ich da gefunden habe, nutze ich, weil ich glaube, dass die Leserinnen und Leser dieses sehr langen Buches vielleicht besser verstehen, worum es mir geht, wenn sie beim Lesen das gleiche Bild als Hintergrund vor Augen haben, wie ich es permanent beim Schreiben hatte. Als Wissenschaftler müssen Sie das sofort wieder lassen. Damit ist aber die persönliche, emotional biografische, familiäre Dimension, politische, nicht passé, die ist da. Das heißt, in dem Moment, in dem Sie als Historiker über den NS schreiben, machen Sie eine Erfahrung, die jeder Wissenschaftler macht oder zumindest machen sollte und auch drüber reflektieren sollte, nämlich dass wissenschaftliche Erkenntnis von dem lebt, was es ausschließt.
Sie können so präzise Erkenntnis stiften, wie Sie, man könnte fast sagen, Askese walten lassen. Da unterscheidet sich der Naturwissenschaftler nicht vom Historiker. Sie können umso mehr sehen und erkennen, je spezifischer, je klarer die Hinsicht, die Perspektive, die Fragestellung, der Aspekt ist. Damit ist gesagt, dass Sie viel ausschließen müssen, und zwar nicht nur Blickwinkel, Perspektiven, Forschungsinteressen, sondern im Fall der Zeitgeschichte auch den Teil der Geschichte, der nach Koselleck nicht nur Teil seiner kognitiven Erinnerung, also der Kriegsteilnehmer, sondern wirklich auch seines Leibes ist. Das ist ein Geschehen, die Erinnerung ist Teil des Körpers geworden. Das betrifft in diesem Fall, insbesondere mit der Herkunft aus dem Täterkollektiv oder aus einem Opferkollektiv, ihr eigenes Leben. Das ist die einzige praktische Einsicht, die ich von der Leine gelassen habe, der ich dann freien Lauf gelassen habe, dass ich merkte, mit meiner Dissertation ist der Stoff für mich nicht auserzählt. Dann habe ich in dem sogenannten Roman nichts anderes gemacht, als den gleichen Stoff ohne die Beschränkung, von der die Wissenschaft lebt, zu erzählen und plötzlich entsteht was völlig Anderes. Ein Buch, das in vielen Passagen durchaus essayistische, sachbuchhafte Züge hat, aber als Ganzes Literatur ist, weil es keine These verfolgt, sondern versucht, diese Vielfalt, die Sie als Wissenschaftler reduzieren müssen, zu orchestrieren. Es entsteht plötzlich was ganz Anderes, es ist kaum etwas erfunden, vielleicht fünf, sechs fiktive Details, ansonsten ist alles recherchiert und authentisch. Aber es ist doch Literatur, weil es nicht eine These vertritt, sondern die Vielfalt orchestriert, die Sie als Wissenschaftler reduzieren müssen. Dann kommt als dritte Dimension das publizistisch essayistische dazu, die nicht nur die Vergangenheit selbst thematisiert, sondern auch unsere Thematisierung zum Thema macht. Da haben Sie die ganze Vielfalt der möglichen Betrachtungsweisen, die in meinen unterschiedlichen Texten Gestalt angenommen haben.
Es öffnet auch den Raum, dass alle dazu beitragen können, Kunst, Kultur, Literatur.
Ganz genau. Wenn ich zum Beispiel Kritik am Holocaust-Mahnmal übe oder an anderen Mahnmälern, dann heißt das nicht, dass man stattdessen nur der Wissenschaft, nur der Erzählung oder der Literatur das Wort redet. Nein, es gibt großartige Denkmäler. Denkmäler sind nötig, sie sind nur im deutschen Fall sehr kompliziert oder treffen auf ein kompliziertes Problem und sind dementsprechend kritisierbar. Die Kritik läuft nicht auf keine Denkmäler hinaus, sondern impliziert, unbedingt Denkmäler, nur bessere.
Ja. Das ist ein Statement. Ich habe noch eine letzte Frage auf meiner Liste und zwar zur Funktion von Geschichte und Erinnerung. Warum und zu welchem Zweck erinnern wir uns, können wir aus der Geschichte lernen oder die Frage, die ich lieber stellen würde, was braucht es, dass wir aus der Geschichte lernen, dass wir ein „nie wieder“ auch wirklich praktizieren?
Das „nie wieder“. Dafür gibt es plausible Gründe und es ist auch gut gemeint, in der Realität überspringt dieses „nie wieder“ aber die entscheidende Frage. Diese Frage hat es in sich, nämlich, was denn nie wieder? Das heißt, in dem Moment, wo Sie „nie wieder“ sagen, müssen Sie eine Antwort auf das geben, was damals geschehen ist. Genau damit sind Sie mittendrin in unfassbar komplizierten Fragen, die sich aus guten Gründen nur wissenschaftlich lösen lassen und auch aus guten Gründen unter Wissenschaftlern umstritten sind. Ein Beispiel, schon die Frage, was war der Holocaust, hat nicht umsonst über Jahrzehnte die besten Köpfe aus verschiedenen Fächern nicht nur zu gemeinsamen Erkenntnissen, sondern auch zu scharfen wissenschaftlichen Kontroversen, die geführt werden müssen, gebracht. Das heißt, es ist beschämend banal zu sagen, dass Auschwitz sich nie wiederholen möge, aber die Frage, wie es zu Auschwitz gekommen ist, die hat es in sich.
Ja.
Das heißt, in dem Moment, in dem Sie Postulate für die Gegenwart formulieren wollen, in Rückbindung an die Vergangenheit, sind Sie schon in der Sackgasse. Es ist unvermeidlich, dass Sie in dem Moment, wo Sie das tun, nicht mehr Moral oder Politik betreiben, sondern Geschichtspolitik. Genau das können wir gegenwärtig feststellen. Ich gebe Ihnen völlig recht, wir brauchen nicht mehr als ein paar universelle Postulate, die glücklicherweise auch in unserer Verfassung niedergeschrieben sind, um uns zu fragen, was dürfen wir und was dürfen wir nicht? Im Übrigen sind diese Postulate, auch wenn sie noch kein Verfassungsrang hatten, auch 1942 schon in der Welt gewesen. Die Leute wussten, dass das Verbrechen sind. Die mussten sich mit unglaublicher kognitiver Gewalt eine Sondermoral erfinden, weil sie wussten, dass es Verbrechen sind. Sie haben nicht umsonst ihre Spuren ausgelöscht. Das heißt, man muss, um es ganz zugespitzt zu sagen, gar nicht wissen, dass Auschwitz stattgefunden hat, um zu wissen, dass Auschwitz nie hätte geschehen dürfen oder nie wieder, wenn Sie so wollen, geschehen darf. Deswegen bin ich da mittlerweile echt radikal, indem ich sage, wir brauchen die Vergangenheit nicht, zumindest nicht in erster Linie, um zu wissen, was wir tun dürfen und was nicht, was falsch ist und was richtig ist.
Eine andere Frage ist, ob sich, Stichwort lernen aus der Geschichte, durch intensives Studium, durch vergleichende Studien, durch spezifische Fragestellungen Erkenntnisse gewinnen lassen, zum Beispiel hinsichtlich der Frage, wie entsteht Massengewalt? Unter welchen Umständen entsteht Massengewalt? Welche Faktoren müssen zusammenkommen, damit so etwas wie ein Genozid, auch wenn der Begriff umstritten ist, stattfindet? Es ist möglich, Konfliktforschung zu betreiben. Das ist aber was Anderes als der einerseits vollkommen selbstverständlich und zugleich inhaltsleere Slogan „nie wieder“. Ich würde dafür plädieren zu sagen, es gibt ein paar sehr fundamentale Postulate, also Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit, die einem schon ausreichend Handhabe dafür geben, was geht und was nicht geht. Auf der anderen Seite würde ich dafür plädieren, die Geschichte in ihrer ganzen Kompliziertheit, in der Unaufgeräumtheit aus sich selbst heraus begreifen zu wollen. In dem Moment, wo Sie das tun, können Sie nicht umhin, als immer wieder die Brücke zur Gegenwart zu schlagen. Es gibt aus meiner Sicht viele gute Gründe, sehr zurückhaltend zu sein mit den vermeintlichen Lehren aus der Geschichte oder dem Übertrag aus der Vergangenheit auf die Gegenwart. Natürlich kann man das trotzdem tun, und zwar gewinnbringend tun, aber dann mit kühlem Kopf.
Herr Leo, vielen vielen Dank für Ihre Zeit und dieses spannende Gespräch.
Ja, danke.
Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Es war super, es ist immer großartig, Zeit zu haben.
Gabriele Woidelko: Das war unser History & Politics Podcast mit Per Leo zu aktuellen Konfliktlinien rund um unseren Umgang mit Geschichte und Erinnerung. Weiterführende Links finden Sie in den Shownotes und auf unserer Webseite, wo Sie auch das Manuskript zur Folge nachlesen können. Weitere Informationen zu unseren Aktivitäten rund um Geschichte und Erinnerung im Bereich Geschichte und Politik der Körber-Stiftung finden Sie auf unserer Stiftungswebseite. Da gibt es auch alle Folgen des History & Politics Podcasts. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast haben, schreiben Sie uns gern eine E-Mail an gp@koerber-stiftung.de. Vielen Dank fürs Zuhören, hoffentlich bis zur nächsten Folge, machen Sie es gut, tschüss.

Geschichte ist Gegenwart! Der History & Politics Podcast der Körber-Stiftung
Warum Geschichte immer Gegenwart ist, besprechen wir mit unseren Gästen im History & Politics Podcast. Wir zeigen, wie uns die Geschichte hilft, die Gegenwart besser zu verstehen.
-
Is Globalization unstoppable? Insights from the Past#73 38 Min. 12. Jun 2024
-
Moldau: Perspektiven eines zerrissenen Landes#66 35 Min. 7. Mai 2024
-
The New Germany S03E06: Extremism: Defending Democracy in Past and Present#72 50 Min. 9. Apr 2024
-
Über die Geschichte einer gewaltfreien Gesellschaft#71 45 Min. 2. Apr 2024
-
The New Germany S03E05: Social Transformation: What is German?#70 53 Min. 26. Mrz 2024
-
The New Germany, S03E04: Made in Germany: Industry and Deindustrialisation#69 49 Min. 12. Mrz 2024
-
History in the Age of Disinformation#68 51 Min. 5. Mrz 2024
-
The New Germany, S03E03: Germany and the US: Cowboys and Keynesians#67 51 Min. 27. Feb 2024
-
Distance and emotion: Ukrainian historians in war times#65 53 Min. 20. Feb 2024
-
The New Germany, Season 3 - Episode 2: Germany and France: A Marriage on the Rocks#64 56 Min. 13. Feb 2024
-
The New Germany, Season 3 - Episode 1: Crisis Chancellors#63 55 Min. 30. Jan 2024
-
Technologien gegen das Vergessen#62 36 Min. 27. Jan 2024
-
Amerika – das Ende eines Traums?#61 64 Min. 12. Dez 2023
-
The New Germany, S02E07: Grenzen überwunden? Das Verhältnis zwischen Ost und West#60 84 Min. 14. Nov 2023
-
Zwischen Moral und Realpolitik: Das deutsch-israelische Verhältnis#59 46 Min. 12. Sep 2023
-
Chatting with the Past#58 47 Min. 8. Aug 2023
-
Die Arktis – Von der Friedenszone zur internationalen Konfliktzone#57 37 Min. 4. Jul 2023
-
Zeitenwende and the Return of History#56 44 Min. 8. Jun 2023
-
Polen und Europa seit 1989#55 33 Min. 30. Mai 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 6: German Politics in Flux#54 43 Min. 9. Mai 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 5: German Schuldenangst#53 46 Min. 25. Apr 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 4: Germany’s Grand Strategy#51 48 Min. 11. Apr 2023
-
Politik unter Einsatz des Körpers#52 42 Min. 6. Apr 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 3: Germany and Poland#49 47 Min. 28. Mrz 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 2: Germany and China#48 51 Min. 14. Mrz 2023
-
Das Jahr 1923 und German Schuldenangst#47 40 Min. 7. Mrz 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 1: Germany’s Russians#46 54 Min. 28. Feb 2023
-
Rechte Geschichtsbilder im Video-Gaming#45 47 Min. 15. Feb 2023
-
Asylpolitik: Eine Konfliktgeschichte#44 32 Min. 12. Jan 2023
-
Aktivist:innen in Russland: Zwischen Untergrund und Friedensnobelpreis#43 35 Min. 6. Dez 2022
-
Das Ringen um die neue Weltordnung#42 43 Min. 21. Nov 2022
-
Ukraine: Eine Nation unter Beschuss#41 45 Min. 21. Okt 2022
-
Wohnen – wo Privates politisch ist#40 32 Min. 6. Sep 2022
-
The New Germany, Part 4: The Lid of History#39 52 Min. 22. Aug 2022
-
The New Germany, Part 3: German Energy Policy and Russian Gas#38 43 Min. 8. Aug 2022
-
The New Germany, Part 2: A Love-Hate Relationship#36 57 Min. 25. Jul 2022
-
Russia: When History Becomes a Weapon (Englische Folge)#34 40 Min. 19. Jul 2022
-
The New Germany, Part 1: The Bundeswehr and Germany's Mindset#35 42 Min. 12. Jul 2022
-
Erinnerung hat Konfliktpotenzial – Wie sich unser Blick auf Geschichte ändert#33 48 Min. 7. Jun 2022
-
Krieg in der Ukraine: ein historischer Wendepunkt?#32 35 Min. 31. Mai 2022
-
Geschichte und Erinnerung in Games#31 28 Min. 3. Mai 2022
-
Belarus: Was bleibt von den Protesten 2020?#30 30 Min. 8. Mrz 2022
-
Sind Russland und China heute Imperien?#29 39 Min. 8. Feb 2022
-
#30PostSovietYears: Kann Kunst versöhnen?#28 39 Min. 30. Nov 2021
-
China – Modernisierung zwischen Isolation und Öffnung#27 39 Min. 28. Okt 2021
-
Deutschland und Polen - Geschichte und Zukunft einer guten Nachbarschaft#26 42 Min. 23. Sep 2021
-
Russland - Großmacht mit historisch gewachsenem Sonderstatus?#25 33 Min. 24. Jun 2021
-
Belarus – Über Proteste, Demokratie und Diaspora#24 39 Min. 29. Apr 2021
-
Die Vorgeschichte der Hohenzollern-Debatte. Adel, Nationalsozialismus und Mythenbildung nach 1945.#23 54 Min. 25. Mrz 2021
-
Jüdisches Leben in Deutschland seit 1945#20 50 Min. 25. Feb 2021
-
Deutschland und Frankreich – Fremde Freunde?#22 40 Min. 27. Jan 2021
-
Geschichtsvermittlung ist eine Zukunftsbranche#21 27 Min. 17. Dez 2020
-
Tatjana Tönsmeyer: Das europäische Erbe der NS-Besatzungsherrschaft#19 34 Min. 26. Nov 2020
-
Natasha A. Kelly: Rassismus und die Geschichte Schwarzer Menschen in Deutschland#18 40 Min. 19. Okt 2020
-
Sandra Günter: Sport macht Gesellschaft?#17 37 Min. 24. Sep 2020
-
Stefanie Middendorf: Geschichte der Staatsverschuldung: Kredite für die öffentliche Hand#16 40 Min. 27. Aug 2020
-
Helene von Bismarck: Großbritannien und die EU – ein historisches Missverständnis?#15 34 Min. 27. Jul 2020
-
Aleida Assmann: Was hält Europas Sterne zusammen?#14 24 Min. 25. Jun 2020
-
Birte Förster: Rolle rückwärts bei der Gleichberechtigung?#13 29 Min. 8. Jun 2020
-
Till van Rahden: Demokratie in Krisenzeiten#12 30 Min. 6. Mai 2020
-
Elke Gryglewski: Alles gesagt, alles gezeigt?#11 23 Min. 17. Apr 2020
-
Frank Uekoetter: Pandemien und Politik#10 25 Min. 27. Mrz 2020
-
Mary Elise Sarotte: Die NATO-Osterweiterung.#9 29 Min. 20. Nov 2019
-
Werner Plumpe: Die Kraft des Kapitalismus.#8 21 Min. 23. Okt 2019
-
Ilko-Sascha Kowalczuk: 30 Jahre Mauerfall – und nun?#7 23 Min. 1. Okt 2019
-
Claudia Weber: Kriegsausbruch 1939#6 24 Min. 11. Jul 2019
-
Jason Stanley: Faschismus damals und heute#5 18 Min. 4. Jul 2019
-
Philip Murphy: Rule Britannia?#4 24 Min. 27. Jun 2019
-
Hedwig Richter: Volksbegehren oder Staatsgewalt?#3 22 Min. 20. Jun 2019
-
David Ranan: Israelkritik und Antisemitismus#2 22 Min. 13. Jun 2019
-
Eckart Conze: Von Versailles 1919 zu den „Neuen Kriegen“#1 28 Min. 28. Mai 2019