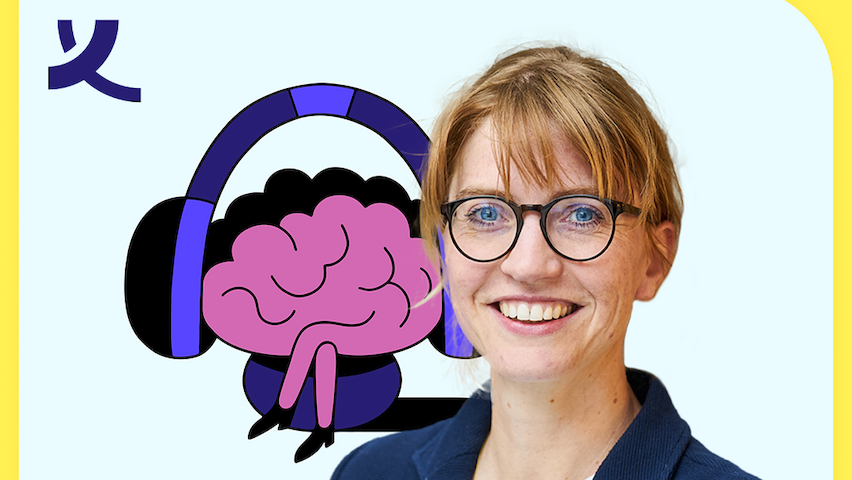Eckart Conze: Von Versailles 1919 zu den „Neuen Kriegen“
Geschichte ist Gegenwart! Der History & Politics Podcast der Körber-Stiftung
Europas Sicherheit und Bündnispolitik.
Der Vertrag von Versailles vom Juni 1919 brachte keinen dauerhaften Frieden. Stattdessen bestimmten das Misstrauen der ehemaligen Kriegsgegner und das Erstarken der extremen Rechten die Nachkriegsordnung. Was lässt sich aus dem Friedensvertrag von Versailles für die Diskussion über Sicherheitspolitik und „neue Kriege“ in Europa lernen? Ein Gespräch mit dem Historiker Eckart Conze.
Das 20. Jahrhundert in Europa erscheint rückblickend als zweigeteilt. Die erste Hälfte geprägt von zwei Katastrophen mit apokalyptischen Anmutungen, dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Die zweite fast ohne Krieg, aber erstarrt inmitten der Angst vor einer tatsächlichen Apokalypse. Nach dem Ersten Weltkrieg brachte der Vertrag von Versailles vor 100 Jahren keinen dauerhaften Frieden. Die Zwischenkriegsordnung war geprägt durch das Misstrauen der ehemaligen Kriegsgegner und dem Erstarken der extremen Rechten. Auf die Weltkriegs-Epoche folgte eine Nachkriegsordnung, die geprägt war vom Systemkonflikt zwischen Ost und West, Kommunismus und Kapitalismus. Gründung der Bundesrepublik und der DDR, des Warschauer Paktes und der NATO. Heute besteht die Gefahr neuer Kriege. Die Transatlantischen Beziehungen stecken in der Krise.
Heiner Wember: Welche Sicherheitsbedürfnisse hatte Europa im 20. Jahrhundert? Wie ist der Kontinent Europa in gegenwärtigen Zeiten der inneren und äußeren Unsicherheit geschützt? Das alles sind für Eckart Conze fast Lebensfragen, denn er beschäftigt sich als Historiker immer schon mit diesen Themenbereichen. Willkommen Eckart Conze. Herr Conze, fühlen Sie sich sicher auf Ihrem Kontinent in Ihrer Zeit?
Eckart Conze: Ich fühle mich sicher, aber ich nehme auch zur Kenntnis, dass gerade derzeit das Gefühl und die Wahrnehmung von Unsicherheit in nahezu allen Gesellschaften wachsen und dass die Frage von Sicherheit, von Unsicherheit ein zentrales, um nicht zu sagen das beherrschende politische Thema unserer Zeit ist. Nicht nur die klassische Frage von Sicherheit, Krieg und Frieden, sondern Sicherheit in ganz unterschiedlichen Politikbereichen und Politikfeldern: Umwelt, Klima, Gesundheit. Was wir seit einigen Jahren erleben, ist eine unglaubliche Erweiterung unseres Sicherheitsverständnisses, unseres Sicherheitsbegriffs, festgemacht an immer neuen Unsicherheitswahrnehmungen, Unsicherheitspotenzialen, tatsächlichen oder vermeintlichen, die als Thema ganz massiv auf die Politik unserer Gegenwart einwirken und auch die Wahrnehmung unserer gegenwärtigen Welt bestimmen und beeinflussen.
Welche Formen von Sicherheit gibt es denn? Innere Sicherheit, äußere Sicherheit?
Das wäre so die klassische Form, innere Sicherheit, äußere Sicherheit. Man könnte dann als drittes noch die soziale Sicherheit mit hinzunehmen, diese klassische Trias, die ist lange etabliert, reicht zurück mindestens ins 19. Jahrhundert. Aber zum einen stimmen die Parameter nicht mehr. Was ist heute innere Sicherheit, was ist äußere Sicherheit? Wenn wir über internationale Kriminalität sprechen, über Terrorismus, sind das Fragen innerer Sicherheit? Sind das Fragen äußerer Sicherheit? Die Grenzen verschwimmen, die Grenzen zwischen diesen Sicherheitsbereichen werden fließend, es kommen andere Sicherheitsdimensionen hinzu im Bereich von Gesundheit und Umwelt beispielsweise. Sodass das Thema Sicherheit insgesamt vielgestaltiger geworden ist, aber auch wichtiger und komplexer als politische Herausforderung.
Dabei ist gar nichts sicher, außer der Tod.
Das ist richtig. Ich meine, Sicherheit ist auch ein anthropologisches Grundbedürfnis, die Sicherheit von Leib und Leben. Der gesamte Aufstieg des modernen Staates, so wie wir ihn heute kennen, verdankt sich eigentlich den Logiken von Sicherheit und Unsicherheit. Der moderne Staat entwickelt sich im 16., im 17. Jahrhundert mit dem Versprechen an seine Bürger oder seine Untertanen: Ich gebe euch Sicherheit. Das legitimiert den Staat, das legitimiert staatliche Strukturen, das legitimiert staatliche Macht, staatliche Gewalt. Und das ist bis heute ein zentrales Element von Staatlichkeit. Ein historisches Thema von langer Dauer.
Sie sprechen von einem Sicherheitsdilemma. Was ist das?
Ein Sicherheitsdilemma ist, dass die Sicherheit des einen in sehr, sehr vielen Fällen sich verbindet mit der Unsicherheit des anderen. Gerade in Bereichen von Militär, von Krieg und Frieden, von Rüstung, Aufrüstung ist das immer wieder zu erkennen. Man trifft für sich selbst, für die eigene Seite Sicherheitsmaßnahmen im Bereich der Rüstung, im Bereich des Militärs. Daher stammt dieser Begriff des Sicherheitsdilemmas auch ursprünglich. Und diese Versuche, die eigene Sicherheit zu erhöhen, tragen wiederum auf der anderen Seite zu einer tatsächlich oder wahrgenommenen größeren Unsicherheit bei, dann setzen sich Rüstungsspiralen, Rüstungs-Eskalationen in Gang. Das ist das, was man klassisch politikwissenschaftlich schon seit vielen Jahrzehnten als das Sicherheitsdilemma bezeichnet. Aber das lässt sich in dieser Logik natürlich auch auf andere Politikfelder, Politikbereiche übertragen.
Beim Wiener Kongress war man noch so klug zu erkennen, dass die eigene Sicherheit auch mit der Sicherheit der anderen zusammenhängt, hat den Besiegten Frankreich mit einbezogen und sich auch mit ihm geeinigt. Beim Versailler Friedensvertrag sah das ganz anders aus. Dort wurden die besiegten Länder gedemütigt. Ihnen wurde die Kriegsschuld zugesprochen und sie wurden vorgeführt.
Demütigungen hat es sicherlich gegeben, gerade auch gegenüber Deutschland, das den Krieg auch mitbegonnen hatte, nicht alleinschuldig, aber doch mitbegonnen hatte, weil es im Interesse der politischen und militärischen Eliten des Kaiserreiches lag, diesen Krieg vom Zaun zu brechen. Natürlich hat es diese Politik der Demütigungen gegeben nach 1919. Das ist ein moderner Frieden, der 1919 geschlossen wird. Das ist nicht die Situation des Wiener Kongresses 1814, 15, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, wo man sich um den Tisch versammelt und zu mehr oder weniger rationalen Entscheidungen kommt. 1919 haben wir eine ganz andere Situation. Wir reden über Gesellschaften mit Massen-Öffentlichkeiten, auch medialen Öffentlichkeiten, wie es sie 100 Jahre zuvor nicht gegeben hatte. Und wir reden vor allem über einen Friedensschluss nach einem technisch-industriellen Massenvernichtungskrieg, der der Erste Weltkrieg war mit Millionen von Opfern an der Front und in den Heimatgebieten. Und diese Millionen von Opfern, diese Erfahrung von Tod, von Leid, von Gewalt, von Sterben mündet ein in den Friedensschluss nach 1918. Da kann man nicht einfach den Schalter umlegen von Krieg auf Frieden, sondern all diese Erfahrungen des Krieges, aber auch das Ausmaß an Hass, durch die Propaganda auf allen Seiten über die Jahre hinweg genährt, trägt dann dazu bei, dass es so schwierig, im Grunde genommen unmöglich ist, einen Frieden zu schließen, einen stabilen, einen dauerhaften Frieden zu schließen nach dem Ende des Ersten Weltkrieges.
Der Politologe Herfried Münkler sagt, es gab einfach zu viele Tote, als dass man sich auf einen Frieden ohne Sieg hätte verständigen können.
Je länger der Krieg dauert und je größer die Verluste sind auf allen Seiten, desto stärker wächst die Sehnsucht nach Frieden, der Friedenswunsch. Und auf der anderen Seite wird aber zur Mobilisierung der nationalen Ressourcen die Propaganda, gerade in der zweiten Kriegshälfte, noch stärker mobilisiert. Das führt dann zu diesem Hass und auch zu Erwartungen an einen Sieg, an einen Siegfrieden, der überall versprochen wird von der Propaganda in Frankreich, in Großbritannien genauso wie im Deutschen Reich.
Gab es einen direkten Weg von Versailles zu Hitler?
Nein, es gab keinen direkten Weg von Versailles zu Hitler. Was man natürlich sagen kann, ist, dass die Nationalsozialisten und auch andere Rechte, rechtsradikale Gegner der Republik von Anfang an diesen Versailler Frieden benutzt haben, instrumentalisiert haben, um die Weimarer Demokratie zu diskreditieren. Man hat diesen Friedensschluss genauso wie die Revolution den Novemberverbrechern angelastet und damit die Republik diskreditiert, sie schwer belastet und dadurch den eigenen Aufstieg vorangetrieben. Es führt kein zwangsläufiger Weg aus dem Jahr 1918 oder 1919 ins Jahr 33 oder 39. Das würde der Geschichte ihre Offenheit nehmen, die auch von den Zeitgenossen so wahrgenommen worden ist. Und am Ende landet man dann bei dem geradezu perfiden Argument, die Alliierten seien durch ihren Friedensschluss, durch diesen diktierten Frieden schuld gewesen am Aufstieg des Nationalsozialismus.
Hatten die Nationalsozialisten auch einen Sicherheitsbegriff? Sie haben nicht gesagt: Wir wollen Krieg, sondern: Wir müssen für die Sicherheit unseres Volkes sorgen. Wie war dort die Argumentation?
Man argumentierte, für die Sicherheit des eigenen Volkes, der Volksgemeinschaft, zu sorgen. Das war aber nun gleichbedeutend mit der extremen, mit der absoluten Unsicherheit derjenigen, bis hin zur physischen Vernichtung, die nicht zu dieser Volksgemeinschaft gehörten. Die Juden allen voran, aber auch Sinti, Roma und andere verfolgte Gruppen.
Die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg hatte einen Vorteil: Es gab zwei Global Player, die mitspielten. Dadurch war klar, wer gegen wen stand. Es gab keine Bündnisverwicklungen wie vor dem Ersten Weltkrieg mit fünf oder sechs Playern, die in unterschiedlichen Bündnissen zusammen oder gegeneinanderstanden. Diese Situation der NATO die ja tatsächlich dafür sorgte offensichtlich, dass es keinen Krieg gab, war das auch viel Glück oder war es auch Glaubwürdigkeit, dass man wirklich im Zweifelsfall diesen unsäglichen Krieg führen würde?
Das waren ganz andere Bedingungen als nach 1919. Diese klare Zweiteilung, diese Bipolarität und dann eine deutlich betriebene amerikanische Hegemonialpolitik, ganz anders als nach 1919, als die Vereinigten Staaten sich, obwohl sie die mächtigste Siegermacht im Ersten Weltkrieg gewesen sind mit globalem Gewicht als aufsteigende Weltmacht, aber sich dann doch zurückgezogen haben, insbesondere aus den europäischen Dingen. Die Situation nach 1945 sieht auch wegen der sowjetischen Herausforderung tatsächlich oder vermeintlich ganz anders aus, weil die USA als eine Art Lehre aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg sagen: Wir müssen hier präsent sein, und wenn wir unsere hegemoniale Macht ausüben wollen, dann müssen wir als westliche Führungsmacht in Erscheinung treten und einen nicht nur militärischen, sondern auch politischen Bündniszusammenhang entwickeln, der den Westen insgesamt in die Lage versetzt, dieser östlich-kommunistischen Herausforderung zu begegnen. Und genau das passiert in den Jahren nach 1945. Der Westen nimmt nicht nur als Idee Gestalt an, sondern wirklich in Form von klaren politischen Strukturen, Bündnisstrukturen, Institutionen, die diese westliche Welt unter der klaren und unzweideutigen Führung der Vereinigten Staaten in Erscheinung treten lassen.
Die NATO sollte die Russen draußen halten, die USA drinnen und die Deutschen unten.
Das ist ein Bonmot, das dem ersten NATO-Generalsekretär Lord Ismay zugeschrieben wird. Das ist in der Analyse der Situation nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dann vor dem Hintergrund des sich entfaltenden Krieges auch nicht völlig falsch. Wir haben das antikommunistische Element einerseits, die Russen draußen, dann die USA drinnen zu halten. Anders als nach 1919, die USA als eine europäische Macht, wenn man so will. Die deutsche Gefahr, der Zweite Weltkrieg, der Nationalsozialismus liegen wenige Jahre zurück. Das ist nach wie vor, gerade in Europa, eine nicht herbeigeredete, sondern eine sehr reale Bedrohungsperspektive. Aus dieser Bedrohungsperspektive entwickelt dann die Regierung Adenauer in den frühen 50er Jahren ihre Politik der Westintegration, indem sie sagt: Wir integrieren uns, wir binden uns fest ein, auch im Sinne der Selbstkontrolle, in diese westlichen Strukturen, wo man uns auch braucht mit unserem Gewicht, politisch, ökonomisch, aber dann auch sehr rasch militärisch in der Auseinandersetzung mit dem Osten.
Die Wiedervereinigung nach dem Mauerfall 1989 hat nicht mal ein Jahr gebraucht, ging also vergleichsweise schnell. Helmut Kohl kannte alle führenden Politiker, die beteiligt waren. Er hatte ein persönliches Verhältnis zu ihnen. Ihre Kollegin Mary Elise Sarotte aus den USA sagt zwei Dinge. Die eine Aussage ist: Die deutsche Vereinigung war taktisch perfekt gelöst. Würden Sie dem zustimmen?
Das ist sicherlich richtig und das verdankt sich auch der entschlossenen amerikanisch-deutschen Politik in der Phase seit dem Herbst 1989, spätestens seit dem Fall der Mauer November 1989, in diesen berühmtem 329 Tagen bis zum dritten Oktober 1990. Das ist auch eine Vertrautheit und ein abgestimmtes Vorgehen, das nicht von einem Tag auf den anderen entstehen konnte. Sondern hier werden die Früchte einer engen deutsch-amerikanischen Kooperation und Partnerschaft, so wie sie sich seit den 50er Jahren entwickelt hatte, geerntet. Das macht dieses enge, abgestimmte Vorgehen möglich in Verbindung mit einem offensichtlich auch persönlich sehr, sehr guten Verhältnis zwischen dem deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl und dem amerikanischen Präsidenten George Bush, dem Älteren. Gerade diesen beiden gelingt es dann auch, die durchaus skeptischen und zögernden Positionen in Europa, auch im westlichen Europa, wenn man an das Frankreich von François Mitterrand oder Großbritannien unter Margaret Thatcher denkt, zu überwinden und diese wichtigen europäischen Staaten, auch insgesamt die europäische Gemeinschaft, mit ins Boot zu holen. Und es gelingt schließlich dann auch, und das ist mindestens so wichtig, wenn nicht noch wichtiger, die Sowjetunion davon zu überzeugen in diesem Fenster, das sich für einen Moment öffnet im Winter, im Frühjahr 1989, 90, die Sowjetunion mit ins Boot zu holen, sie zu überzeugen, dass die Zustimmung zu einer deutschen Vereinigung, zur deutschen Einheit auch im Interesse der Sowjetunion liegt. Das ist eine Argumentation, die bei dem damaligen Generalsekretär Michail Gorbatschow auf Zustimmung stößt, wenn auch nicht überall ansonsten in Moskau und im Kreml.
Da kommen wir zum wunden Punkt, denn Mary Elise Sarotte sagt auch, taktisch war das eine Meisterleistung, strategisch eher ein Versagen, weil: die NATO blieb bestehen, sie weitete sich nach Osten aus. Kein Wunder, dass die Russen sich heute in die Enge getrieben fühlen.
Das ist eine Wahrnehmung aus der heutigen Perspektive, wo wir tatsächlich angesichts der russischen Politik unter Putin seit den späten 1990er Jahren danach fragen: Was ist denn schiefgegangen? Wo liegen die Probleme? Und dann stößt man in der Tat auf Entscheidungen, vielleicht auch falsche Entscheidungen in der Situation schon des Jahres 1990. Aber man muss einmal mehr auch den Zeitgenossen konzedieren, dass sie nicht Entwicklungen, die zehn, 20 Jahre später eintraten, schon in der Situation des Jahres 1990 vor Augen haben konnten. Gleichwohl sind die Prozesse sowohl der NATO als auch der EU-Osterweiterung der 1990er, der frühen 2000er Jahre aus Moskauer Sicht hochproblematisch im Blick auf die Wahrnehmung dieser Erweiterungsrunden. Und die Frage ist tatsächlich: Hat der Westen hier klug gehandelt? Hätte es nicht andere Möglichkeiten gegeben, Russland kooperativer einzubinden in ein europäisches Sicherheitssystem? Und dann fällt der Blick in der Tat auch zu Recht zurück auf die Entscheidungen des Jahres 1990. Ich will allerdings ergänzen, dass das eine Perspektive ist, die insofern unvollständig ist, weil sie die Interessen der aus sowjetischer Herrschaft gerade sich befreienden osteuropäischen, mittelosteuropäischen, südosteuropäischen Staaten Polen, die Tschechoslowakei zunächst noch, Ungarn, nicht mit einbezieht. Und über die Köpfe dieser Nationen, die gerade erst ihre Unabhängigkeit, ihre Freiheit wiedergewonnen hatten, ließ sich auch in den 1990er Jahren nicht einfach hinwegentscheiden. Man konnte den Polen, den Tschechen, den Ungarn nicht ihre neu gewonnene Souveränität in dem Sinne absprechen, dass man ihnen sagte: Ihr könnt nicht Mitglieder der NATO werden. Ihr könnt nicht Mitglieder der Europäischen Union werden. Es ist wichtig, diese Entwicklungen, diese Interessen und diesen Faktor der neu gewonnenen Souveränität und Unabhängigkeit nach Jahrzehnten imperialer sowjetischer Beherrschung, diesen Punkt mit in die Überlegungen auch zu den 90er, den frühen 2000er Jahren einzubeziehen.
Zum Sicherheitsdenken gehört, dass es Kontakte, eine Spur an Vertrauen gibt. Davon ist im Moment gar nichts mehr da, wenn wir an Wladimir Putin denken, Donald Trump, an die NATO. Auch innerhalb der EU gibt es Probleme. Ist das ein großes Sicherheitsrisiko?
Es ist ein ganz entscheidender Punkt. Sicherheit, gerade in internationale Beziehungen, und zwar kollektive, gemeinsame Sicherheit kann sich nur auf einer Basis des Vertrauens entwickeln. Und eine Basis des Vertrauens wiederum kann nur entstehen durch Kommunikation, durch das Miteinanderreden, das in-Kontakt-Bleiben auch in Krisensituationen. Ein ganz entscheidender Punkt. Wir können, wenn wir wollen, auch wieder zurückblicken auf die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, wo auch zunächst keine stabile Sicherheitsarchitektur in Europa entstehen konnte, weil das Vertrauen zwischen den wichtigsten Protagonisten, allen voran zwischen Frankreich und Deutschland, fehlte. Aber wir sehen doch auch Mitte der 20er Jahre, Stichwort Stresemann, Briand, Locarno-Politik, da entsteht plötzlich Vertrauen als Ergebnis einer behutsamen Politik der Annäherung, des Ausgleichs. Und das lässt dann auch Sicherheitsstrukturen sehr schnell entstehen, die zwar in den 20er Jahren relativ kurzlebig sind, die aber doch existieren. Gerade auch im deutsch-französischen Kontext unter den Bedingungen im Übrigen nach wie vor des Versailler Vertrages, der offensichtlich dann auch solche Entwicklungen zulässt.
Also würden Sie empfehlen, auch mit Wladimir Putin ständig im Kontakt zu bleiben.
Das empfehle ich sehr, bei allen Problemen und bei aller klaren Benennung auch der völkerrechtswidrigen Politik, die von Russland betrieben wird, spätestens seit der Annexion der Krim. Das führt nicht daran vorbei, dass man im Gespräch bleiben muss, um ein Minimum an Kommunikation und ein Minimum auch an Vertrauenspotenzial zu haben. Auch wenn es derzeit so aussieht, als würde das ins Leere laufen und keine konstruktiven Folgen haben. Es ist ganz wichtig, auf allen Ebenen immer wieder bilateral, multilateral im Gespräch zu bleiben, miteinander zu reden, denn alles andere führt nur zu einer Verhärtung und einer Verschärfung der Konfrontation. Und daran kann niemand interessiert sein ernsthaft.
Was ist mit der NATO? Geht es auch ohne?
Die NATO ist in einer ausgesprochen schwierigen Transformationsphase. Die NATO ist eine Struktur, die entstanden ist in der Zeit des Kalten Krieges. Darauf war sie ausgerichtet. Und sie befindet sich im Grunde seit den 1990er Jahren in einem permanenten Anpassungs- und Transformationsprozess. Das ist kein Argument für die Abschaffung der NATO, sondern es ist ein Argument dafür zu überlegen, wie die NATO sich verändernden sicherheitspolitischen Herausforderungen, sicherheitspolitischen Dynamiken, auch als globalen politischen Dynamiken stellen kann. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die ein Ende der NATO postulieren. Aber die Reform, die Transformation der NATO muss sicherlich weiter vorangetrieben werden und sie muss nun endgültig auch ihr strukturelles Erbe, das es doch immer noch gibt aus der Zeit des Kalten Krieges, hinter sich lassen. Das betrifft auch die gesamte Frage, die sich seit Amtsantritt von Donald Trump immer massiver stellt: Was bedeutet eigentlich das transatlantische Verhältnis heute? Gibt es überhaupt noch das, was mal einmal die atlantische oder transatlantische Partnerschaft genannt hat? Mein Eindruck ist, dass dieses transatlantische Verhältnis von der gegenwärtigen Regierung und insbesondere von dem Präsidenten Trump selbst bewusst nicht nur auf das Spiel gesetzt, sondern zerstört wird. Die amerikanische Politik unter Donald Trump ist bewusst dabei, den Transatlantizismus, so wie er sich nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hatte, zu zerstören. Die Europäer sollten gleichwohl ihr Interesse zeigen, die transatlantischen Beziehungen nicht noch weiter erodieren zu lassen. Aber es wird keinen Weg zurück geben in die transatlantischen Beziehungen des Kalten Krieges. Dafür haben sich die auch global-politischen Bedingungen zu sehr verändert. Und das ist auch nicht nur eine Frage der Präsidentschaft von Donald Trump, finde ich.
Sie sprachen davon, dass die NATO in der Transformation ist und sich auch weiter verändern muss. Wohin soll sie sich denn verändern? Was soll am Ende dann dabei herauskommen?
Die NATO muss im Grunde in starkem Maße ein politisches Bündnis sein, das im Kern um die Idee des Westens, der liberalen, der freiheitlichen Demokratie kreist. Und sie ist deutlich mehr als eine militärische Allianz. Sie muss den Versuch machen, das hat sie schon früh in zentralen Dokumenten, auch schon in der Zeit des Kalten Krieges, festgeschrieben, Entspannung, Vertrauensbildung zu verbinden mit Maßnahmen auch der Verteidigungsfähigkeit. Ich glaube, die Herausforderung ist größer geworden, zumal wir uns auch nicht mehr in bipolaren Strukturen bewegen wie in den Jahrzehnten des Kalten Krieges, sondern wieder, ähnlich wie vor, aber auch nach 1919, in einer multipolaren Welt. Die NATO ist ein Kind des Kalten Krieges, einer bipolaren Welt, und insofern muss sie dieser Systemtransformation auch begegnen und sich als Organisation westlicher Politik in einer multipolaren Welt jetzt nicht neu erfinden, aber doch erheblich transformieren.
Der zukünftige Krieg wäre eher ein Cyberkrieg. Oder wie sähe der aus?
Das ist zu vermuten. Vermutlich müssen wir Abschied nehmen von unserer Vorstellung des traditionellen Krieges, des Schießkrieges. Der Krieg der Zukunft wird anders ausgetragen werden, als Cyberkrieg mit Angriffen auf Infrastrukturen, mit der Lahmlegung vitaler Systeme in den Gesellschaften. Aber die Frage ist auch, ob nicht bereits die auch im Cyberraum, im digitalen Raum stattfindenden Einmischungs- und Manipulationsversuche, vielleicht nicht als Form eines neuen Krieges zu betrachten sind, aber doch als Form der Einmischung, der Intervention. Hier verändern sich auch die Austragungsformen von Konflikten. Und auch das sind Herausforderungen, denen nicht nur ein Bündnis wie die NATO, sondern auch die Europäische Union zu begegnen hat. Der Krieg der Vergangenheit, für den die NATO gegründet worden war, einschließlich der elaborierten, nuklearen Abschreckungen mit ihren, auch moralisch hochfragwürdigen Prämissen, dieser Krieg der Vergangenheit ist zwar nicht völlig vom Tisch, wird aber doch ergänzt und tendenziell abgelöst durch neue Formen des Krieges, die wir im Grunde heute erahnen, beziehungsweise deren Bedrohungspotenzial doch allmählich auch klarer erkennbar wird.
Wenn wir zum Begriff Sicherheit zurückkommen: Er ist diffuser geworden. Ich weiß nicht, was vor sich geht im Netz, welche Trojaner am Werk sind, wer gerade welche Wahlen beeinflusst. Die allgemeine Verunsicherung nimmt dadurch zu.
Die allgemeine Verunsicherung nimmt zu. Da sind wir wieder bei dem Punkt, diese Hauptherausforderung von Politik, dieser allgemeinen Verunsicherung zu begegnen, die Zukunft noch klarer zu bestimmen, das ist immer ein ganz wesentliches Ziel sicherheitspolitischen Handelns, auf Entwicklungen in der Zukunft, auf mögliche Entwicklungen in der Zukunft zu reagieren. Bis hin dann auch zu Maßnahmen zu Politiken der Vorbeugung, der Vorsorge, der Prävention und das scheint mir heute noch wichtiger geworden zu sein, aber auch noch schwieriger, noch komplexer als in den vergangenen Jahrzehnten.
Literatur:
Conze, Eckart: Die große Illusion: Versailles 1919 und die Neuordnung der Welt (Siedler Verlag, 2018)
Conze, Eckart: Geschichte der Sicherheit: Entwicklung - Themen – Perspektiven (Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, 2018)

Geschichte ist Gegenwart! Der History & Politics Podcast der Körber-Stiftung
Warum Geschichte immer Gegenwart ist, besprechen wir mit unseren Gästen im History & Politics Podcast. Wir zeigen, wie uns die Geschichte hilft, die Gegenwart besser zu verstehen.
-
Is Globalization unstoppable? Insights from the Past#73 38 Min. 12. Jun 2024
-
Moldau: Perspektiven eines zerrissenen Landes#66 35 Min. 7. Mai 2024
-
The New Germany S03E06: Extremism: Defending Democracy in Past and Present#72 50 Min. 9. Apr 2024
-
Über die Geschichte einer gewaltfreien Gesellschaft#71 45 Min. 2. Apr 2024
-
The New Germany S03E05: Social Transformation: What is German?#70 53 Min. 26. Mrz 2024
-
The New Germany, S03E04: Made in Germany: Industry and Deindustrialisation#69 49 Min. 12. Mrz 2024
-
History in the Age of Disinformation#68 51 Min. 5. Mrz 2024
-
The New Germany, S03E03: Germany and the US: Cowboys and Keynesians#67 51 Min. 27. Feb 2024
-
Distance and emotion: Ukrainian historians in war times#65 53 Min. 20. Feb 2024
-
The New Germany, Season 3 - Episode 2: Germany and France: A Marriage on the Rocks#64 56 Min. 13. Feb 2024
-
The New Germany, Season 3 - Episode 1: Crisis Chancellors#63 55 Min. 30. Jan 2024
-
Technologien gegen das Vergessen#62 36 Min. 27. Jan 2024
-
Amerika – das Ende eines Traums?#61 64 Min. 12. Dez 2023
-
The New Germany, S02E07: Grenzen überwunden? Das Verhältnis zwischen Ost und West#60 84 Min. 14. Nov 2023
-
Zwischen Moral und Realpolitik: Das deutsch-israelische Verhältnis#59 46 Min. 12. Sep 2023
-
Chatting with the Past#58 47 Min. 8. Aug 2023
-
Die Arktis – Von der Friedenszone zur internationalen Konfliktzone#57 37 Min. 4. Jul 2023
-
Zeitenwende and the Return of History#56 44 Min. 8. Jun 2023
-
Polen und Europa seit 1989#55 33 Min. 30. Mai 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 6: German Politics in Flux#54 43 Min. 9. Mai 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 5: German Schuldenangst#53 46 Min. 25. Apr 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 4: Germany’s Grand Strategy#51 48 Min. 11. Apr 2023
-
Politik unter Einsatz des Körpers#52 42 Min. 6. Apr 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 3: Germany and Poland#49 47 Min. 28. Mrz 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 2: Germany and China#48 51 Min. 14. Mrz 2023
-
Das Jahr 1923 und German Schuldenangst#47 40 Min. 7. Mrz 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 1: Germany’s Russians#46 54 Min. 28. Feb 2023
-
Rechte Geschichtsbilder im Video-Gaming#45 47 Min. 15. Feb 2023
-
Asylpolitik: Eine Konfliktgeschichte#44 32 Min. 12. Jan 2023
-
Aktivist:innen in Russland: Zwischen Untergrund und Friedensnobelpreis#43 35 Min. 6. Dez 2022
-
Das Ringen um die neue Weltordnung#42 43 Min. 21. Nov 2022
-
Ukraine: Eine Nation unter Beschuss#41 45 Min. 21. Okt 2022
-
Wohnen – wo Privates politisch ist#40 32 Min. 6. Sep 2022
-
The New Germany, Part 4: The Lid of History#39 52 Min. 22. Aug 2022
-
The New Germany, Part 3: German Energy Policy and Russian Gas#38 43 Min. 8. Aug 2022
-
The New Germany, Part 2: A Love-Hate Relationship#36 57 Min. 25. Jul 2022
-
Russia: When History Becomes a Weapon (Englische Folge)#34 40 Min. 19. Jul 2022
-
The New Germany, Part 1: The Bundeswehr and Germany's Mindset#35 42 Min. 12. Jul 2022
-
Erinnerung hat Konfliktpotenzial – Wie sich unser Blick auf Geschichte ändert#33 48 Min. 7. Jun 2022
-
Krieg in der Ukraine: ein historischer Wendepunkt?#32 35 Min. 31. Mai 2022
-
Geschichte und Erinnerung in Games#31 28 Min. 3. Mai 2022
-
Belarus: Was bleibt von den Protesten 2020?#30 30 Min. 8. Mrz 2022
-
Sind Russland und China heute Imperien?#29 39 Min. 8. Feb 2022
-
#30PostSovietYears: Kann Kunst versöhnen?#28 39 Min. 30. Nov 2021
-
China – Modernisierung zwischen Isolation und Öffnung#27 39 Min. 28. Okt 2021
-
Deutschland und Polen - Geschichte und Zukunft einer guten Nachbarschaft#26 42 Min. 23. Sep 2021
-
Russland - Großmacht mit historisch gewachsenem Sonderstatus?#25 33 Min. 24. Jun 2021
-
Belarus – Über Proteste, Demokratie und Diaspora#24 39 Min. 29. Apr 2021
-
Die Vorgeschichte der Hohenzollern-Debatte. Adel, Nationalsozialismus und Mythenbildung nach 1945.#23 54 Min. 25. Mrz 2021
-
Jüdisches Leben in Deutschland seit 1945#20 50 Min. 25. Feb 2021
-
Deutschland und Frankreich – Fremde Freunde?#22 40 Min. 27. Jan 2021
-
Geschichtsvermittlung ist eine Zukunftsbranche#21 27 Min. 17. Dez 2020
-
Tatjana Tönsmeyer: Das europäische Erbe der NS-Besatzungsherrschaft#19 34 Min. 26. Nov 2020
-
Natasha A. Kelly: Rassismus und die Geschichte Schwarzer Menschen in Deutschland#18 40 Min. 19. Okt 2020
-
Sandra Günter: Sport macht Gesellschaft?#17 37 Min. 24. Sep 2020
-
Stefanie Middendorf: Geschichte der Staatsverschuldung: Kredite für die öffentliche Hand#16 40 Min. 27. Aug 2020
-
Helene von Bismarck: Großbritannien und die EU – ein historisches Missverständnis?#15 34 Min. 27. Jul 2020
-
Aleida Assmann: Was hält Europas Sterne zusammen?#14 24 Min. 25. Jun 2020
-
Birte Förster: Rolle rückwärts bei der Gleichberechtigung?#13 29 Min. 8. Jun 2020
-
Till van Rahden: Demokratie in Krisenzeiten#12 30 Min. 6. Mai 2020
-
Elke Gryglewski: Alles gesagt, alles gezeigt?#11 23 Min. 17. Apr 2020
-
Frank Uekoetter: Pandemien und Politik#10 25 Min. 27. Mrz 2020
-
Mary Elise Sarotte: Die NATO-Osterweiterung.#9 29 Min. 20. Nov 2019
-
Werner Plumpe: Die Kraft des Kapitalismus.#8 21 Min. 23. Okt 2019
-
Ilko-Sascha Kowalczuk: 30 Jahre Mauerfall – und nun?#7 23 Min. 1. Okt 2019
-
Claudia Weber: Kriegsausbruch 1939#6 24 Min. 11. Jul 2019
-
Jason Stanley: Faschismus damals und heute#5 18 Min. 4. Jul 2019
-
Philip Murphy: Rule Britannia?#4 24 Min. 27. Jun 2019
-
Hedwig Richter: Volksbegehren oder Staatsgewalt?#3 22 Min. 20. Jun 2019
-
David Ranan: Israelkritik und Antisemitismus#2 22 Min. 13. Jun 2019
-
Eckart Conze: Von Versailles 1919 zu den „Neuen Kriegen“#1 28 Min. 28. Mai 2019