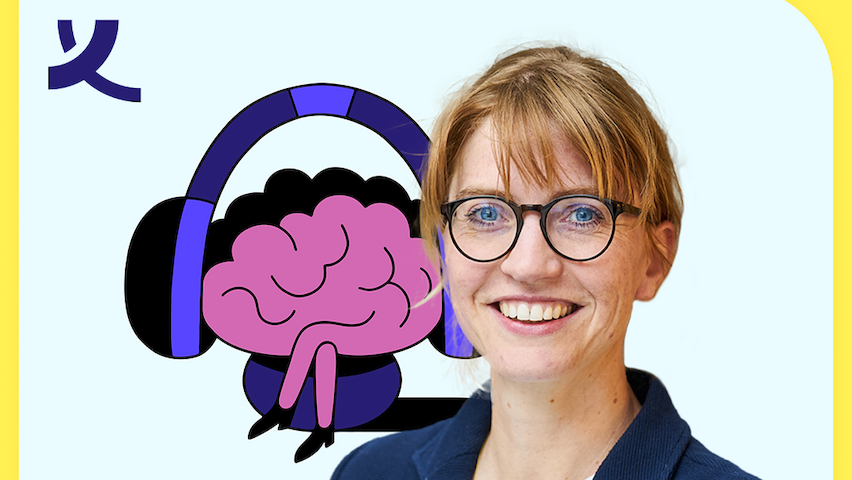Wohnen – wo Privates politisch ist
Geschichte ist Gegenwart! Der History & Politics Podcast der Körber-Stiftung
Wohnen ist privat und gleichzeitig zentral für politische Entscheidungen. Wie hat die Wohnungspolitik der letzten Jahrzehnte Großstädte geprägt? Welche mal als modern geltenden Ideen zum Wohnen sind heute noch brauchbar? Und wie bestimmt das Wohnen die eigene Rolle in der Gesellschaft? Darüber haben wir mit der Historikerin Christiane Reinecke gesprochen.
Abonnieren Sie unseren Podcast! Sie finden uns bei Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts und vielen weiteren Podcatcher.
Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast haben, schreiben Sie uns gern eine E-Mail an gp@koerber-stiftung.de.
Das Manuskript und weitere Informationen zur Podcast-Folge finden Sie auf unserer Podcast-Website.
Folgen Sie uns auf Twitter. Auf unserem KoerberHistory-Twitter-Kanal twittern wir rund um die Aktivitäten unseres Bereichs Geschichte und Politik. Auf unserem eCommemoration-Twitter gibt es alle Informationen rund um Geschichte im Digitalen.
Den Geschichtswettbewerb gibt es auch auf Instagram.
„Grundsätzlich betrifft Wohnen ein Grundbedürfnis. Es gibt kaum etwas, wo Gemeinschaftliches und Privates so sehr miteinander verschränkt sind. Wie wir wohnen ist für uns individuell wichtig, es ist aber eben auch gesellschaftlich wichtig.“
Christiane Reinecke, Historikerin
Weiterführende Informationen
- Mehr über den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten erfahren Sie hier.
Weiterführende Links und Informationen zu dieser Podcastfolge:
- Zur Person Christiane Reinecke.
- Christiane Reinecke: Die Ungleichheit der Städte. Urbane Problemzonen im postkolonialen Frankreich und der Bundesrepublik. Göttingen 2021. Eine Leseprobe gibt es hier.
Informationen vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen zum Thema Wohnen.
Gabriele Woidelko: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von History and Politics, dem Podcast der Körber-Stiftung zu Geschichte und Politik. Mein Name ist Gabriele Woidelko und ich leite in der Stiftung unseren Bereich Geschichte und Politik. Auch heute sprechen wir wieder mit einem Gast darüber, wie die Vergangenheit die Gegenwart prägt.
„Mehr als ein Dach über dem Kopf. Wohnen hat Geschichte“. So lautet das Thema des am 1. September gestarteten Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten, den die Körber-Stiftung seit 1973 ausrichtet. Kinder und Jugendliche sind aufgerufen, auf Spurensuche zu gehen und in der eigenen Familien- oder Lokalgeschichte zum Thema Wohnen zu forschen. Dass das Thema aktuell ist, das merken wir jeden Tag und das zeigt sich auch in vielen öffentlichen Diskussionen: Wohnraum ist eine Schnittstelle zwischen Gesellschaft und uns einzelnen Menschen. Fragen von sozialer Gerechtigkeit, von ökologischer Nachhaltigkeit, aber auch Möglichkeiten zur Teilhabe werden rund um das Thema Wohnen diskutiert. Die aktuellen Debatten sind dabei sehr oft auf Gegenwart oder Zukunft ausgerichtet. Wir wollen heute einen Blick auf die historischen Entwicklungen des Wohnens seit dem Zweiten Weltkrieg werfen, die zentral sind für das Verständnis der heutigen Situation.
Wie also hat die Wohnungspolitik der letzten Jahrzehnte Großstädte geprägt? Welche mal als modern geltenden Ideen zum Wohnen sind heute überhaupt noch brauchbar? Und wie bestimmt das Wohnen die eigene Rolle in der Gesellschaft?
Über diese Fragen hat meine Kollegin Frida Teichert mit Christiane Reinecke gesprochen. Christiane Reinecke ist Professorin für Geschichte an der Europa-Universität Flensburg und arbeitet schwerpunktmäßig zu Stadtgeschichte, zur Geschichte der Migration und zur Wissensgeschichte. 2019 habilitierte sie sich, 2021 publizierte sie ihre Studie unter dem Titel „Die Ungleichheit der Städte. Urbane Problemzonen im postkolonialen Frankreich und der Bundesrepublik“.
Weiterführende Links finden Sie in den Shownotes, die die Sie in Ihrem Podcatcher finden oder natürlich auf unserer Website. Da können Sie auch das Manuskript zu dieser Folge nachlesen.
Frida Teichert: Hallo Frau Reinecke. Sehr schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr, dass wir heute über ein Thema sprechen können, was wahrscheinlich für alle gegenwärtig und aktuell ist. Gleichzeitig ist es ein Thema, was nie weg bzw. für Menschen immer wichtig war, nämlich das Thema Wohnen. Wohnen ist derzeit sowohl in medialen und verschiedenen wissenschaftlichen Diskursen, als auch in politischen Diskussionen und Entscheidungen sehr präsent. Gerne würde ich Sie als Erstes fragen, wie es aus Ihrer Sicht dazu gekommen ist, dass dieses Thema wieder so aktuell ist?
Christiane Reinecke: Grundsätzlich betrifft Wohnen ein Grundbedürfnis. Es gibt kaum etwas, wo Gemeinschaftliches und Privates oder Individuelles so sehr miteinander verschränkt sind, weil wie wir wohnen, das ist nicht nur durch Corona deutlich geworden, für uns individuell, aber auch gesellschaftlich wichtig ist. Ich glaube, dass es im Moment wieder sehr zu einem Thema geworden ist, hängt massiv mit der Entwicklung von Mietimmobilienmärkten in den letzten Jahren zusammen. Wohnungen sind massiv teurer geworden, auch in großen Städten wie beispielsweise Berlin. Das heißt, Wohnraum wird knapper, Wohnen wird teurer. Es hat immer schon Wohnungleichheiten gegeben, aber es gibt eine Verschärfung von Wohnungleichheiten, die dazu führen, dass das Thema stärker auf der politischen Agenda gelandet ist.
Die neue Regierung aus dem letzten Jahr hat im Koalitionsvertrag 400.000 neue Wohnungen im Jahr vereinbart, davon 100.000 öffentlich gefördert. Ob dieses Ziel erreicht wird, werden wir sehen. Es gibt Kritik von einigen Expert:innen, dass diese Zahl nicht ausreichend ist und trotzdem wäre das eine große Zahl in Bezug auf die letzten Jahrzehnte, nicht aber in Bezug auf die 1960er. Da hatte der öffentlich geförderte Wohnungsbau aus ganz anderen Gründen einen sehr großen Anteil. Können Sie etwas zu der Wohnungsnot nach dem Zweiten Weltkrieg sagen? Wie und mit welchen Zielen, mit welchen Maßnahmen hat sich Wohnungsbaupolitik seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis heute grob entwickelt?
Zur aktuellen Wohnungsbaupolitik könnte man viel sagen. Die Wohnungsnot nach dem Zweiten Weltkrieg hatte im deutschen und den meisten europäischen Kontexten Kriegszerstörung und lang ausbleibende Investitionen als Vorgeschichte. Es gibt Unterschiede nach Land und wenn es darum geht, wann Urbanisierungsschübe, Umzüge vom Land in die Stadt, stattfinden, weil das die Wohnungsnachfrage in Städten erhöht. In Frankreich zum Beispiel fand ein später Urbanisierungsschub statt, was in den 50er/60er Jahren zu einer erhöhten Wohnungsnot führte.
Klar ist, Hintergründe sind einerseits Kriegszerstörungen, die je nach Land unterschiedlich ausgeprägt waren, und lange ausbleibende Investitionsschübe, es ist wenig gebaut oder repariert worden. Das heißt, es gab einen sehr ausgeprägten Mangel an Wohnraum, mit regionalen Unterschieden, am meisten in großen Städten, aber prinzipiell flächendeckend. Eines der Instrumente, das massiv eingesetzt wurde, ist Neubau und staatlich subventionierter Neubau. Da gibt es große Unterschiede, wie groß das Bauvolumen ist und wie sehr staatlich finanziert. Westdeutschland, also die Bundesrepublik, wäre sicherlich ein Beispiel für ein sehr starkes Setzen auf staatlich subventionierten Neubau in den 50er/60er Jahren, ergänzt durch eine Reihe von anderen Maßnahmen. Staatlich subventionierter Eigenheimbau hat schon in den 50/50er Jahren begonnen, in den 70er/80er Jahren hatte er aber einen deutlich größeren Anteil. Ergänzt wurde der Neubau durch beispielsweise Mietpreisbindungen in Altbauvierteln. Also ein starkes Setzen der Grenzen davon wie weit Miete gesteigert oder überhaupt eingenommen werden darf.
Das sind zentrale Instrumente von Wohnungspolitik der 50er/60er Jahre in der Bundesrepublik und was in den frühen 70er Jahren einsetzt, ist eine relativ starke Wende. Auf Bundesebene, also unabhängig von einzelnen Inseln, ist statistisch gesehen die Nachfrage nach Wohnraum mittlerweile mehr oder weniger durch vorhandenen Wohnraum abgedeckt, und deswegen – so die Maßgabe – brauchen wir weniger Neubau. Hinzu kam, dass Wohnungsbau und Neubauten teurer geworden sind. Bodenpreise sind teurer geworden, alles ist teurer geworden. Es gab auch deswegen einen massiven Rückgang der pro Jahr neuerbauten Wohnungen ab den frühen 70er Jahren, weil Wohnungsbau so viel teurer geworden ist. Das heißt, es gibt im Laufe der 70er Jahre einen massiven Rückgang von Neubau und eine letztendlich an Einfluss gewinnende Kritik an sozialem Wohnungsbau. Es ist aber so, dass das in großen Städten begleitet worden ist von Auseinandersetzungen mit Sanierungsvierteln. Die klassische von modernen, modernistischen Annahmen geprägte Stadtpolitik der 50er/60er Jahre war dafür, Altbauviertel mit einem Kahlschlag zu sanieren, also mehr oder weniger platt zu machen und durch Neubau zu ersetzen. Es wächst der Widerstand gegen diese Form von Beseitigung alter Baustrukturen. Es setzt eine Parallelität von unterschiedlichen Entwicklungen im Wohnungsbau ein, die einerseits eine Absage an nicht nur sozialen Wohnungsbau beinhaltet, sondern auch an modernistische Stadtplanung, weil es lange verknüpfte Prozesse waren. Eine höhere Wertschätzung von Sanierungsbauten, eine in innerstädtischen Vierteln immer an Bedeutung zunehmende alternative Wohnkultur, die teilweise auf Besetzung setzt und auch setzen muss, wenn sie irgendwie der Kahlschlagsanierung entgegenstehen will, setzt ein. Eine sich im Laufe der 80er Jahre erneut abzeichnende Wohnungskrise entsteht. In den 80er Jahren wird deutlich, dass in bestimmten Wohnkontexten für bestimmte Gruppen wieder Wohnraum fehlt. Diese Abfolge von Wohnungskrise und beseitigter Wohnungskrise findet auf so einer Diskussionsebene in dem Zeitraum von den 50er bis zu den 90er Jahren immer wieder statt. Die 80er Jahre sind ein Nebeneinander von ganz unterschiedlichen Entwicklungen, die entweder zum Ende kommen oder neu anfangen.
Da gab es in den letzten Jahren durchaus einen Kipppunkt, weil sozialer Wohnungsbau wieder deutlich stärker in den Fokus gerückt ist. Die Diskussion um Neubau, Bodenversiegelung, Sanierung auf der anderen Seite, auch diese Debatten sind aktuell sehr gegenwärtig. Würden Sie sagen, weil Sie diese Abfolge gerade beschrieben haben, dass es da große Parallelen zu bestimmten Diskussionen gibt, die es schon seit den 50ern gibt?
Ja und nein. Es gibt ein paar Dinge, die sich entscheidend verändert haben. Der Beginn dieser Veränderungen liegt in Teilen in den 80er Jahren, dazu gehört die massive Veräußerung von Wohnungsraum in öffentlichen Besitz. Im Vergleich zu dem, was an Wohnraum im öffentlichen Besitz in den 60er Jahren war, bedeutet das eine massive Veränderung. Was auch eine massive Veränderung für das Wohnen, den Umgang damit und letztendlich auch für die Wohnungleichheiten bedeutet, unabhängig von der übrigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, ist, wie sehr Wohnen privates Anlageobjekt geworden ist. Es ist schon immer so, dass Leute mit Wohnen Geld verdient haben, aber es gibt einen fundamental veränderten globalen Immobilienmarkt und Investitionsmarkt. Es gibt viel mehr Wohnen als Kapitalanlage. In diesem Nebeneinander von Abbau von Wohnungsbeständen im öffentlichen Besitz und der Ökonomisierung oder Finanzialisierung von Wohnen gab es Veränderungen, die wiederum andere Voraussetzungen schaffen dafür, wie teuer wohnen ist, wer wo wohnt und wie wohnungspolitisch damit umgegangen wird. Es gibt Veränderungen im Wohnen und in der Art und Weise, wer wo wohnt und in Vorlieben für Wohnräume. In Teilen wurde dies unter Stichworten wie Gentrifizierung diskutiert, als eine andere Aufwertung von bestimmten Wohnräumen vor allem von Altbauwohnungen und bestimmten Wohnlagen in Städten. Es gibt auch Unterschiede zu den 60er und 70er Jahre im Wohnen und der Frage, wer wo wohnt, die viel mit Prozessen von, wie verändern sich Innenstädte, wer wohnt in Städten, wer möchte in Städten wohnen, zu tun haben. Was auch unterschiedlich ist: Es hat eine Kritik an sozialem Wohnungsbau gegeben, die seit einigen Jahren zurücktritt gegenüber den neuen Diskussionen um Modelle des öffentlich subventionierten oder finanzierten Wohnraums, weil andernfalls Wohnungleichheiten nicht zu beheben oder auszugleichen sind. Das heißt, gegenüber einer massiven Kritik an sozialem Wohnungsbau erstarkt eine Diskussion, die fragt, ob wir nicht Unterstützung in Wohnsegmenten für Gruppen, die nicht einkommensstark sind, brauchen. Das ist eine Verschiebung der Diskussion.
Die Ökonomisierung des Wohnens steht in einem engen Zusammenhang, das haben Sie schon angeschnitten, mit den Möglichkeiten, aber auch mit den Grenzen an bestimmten Orten zu wohnen. Da würde ich vor allem den Blick auf die Großsiedlungen, mit denen Sie sich in Ihrer Habilitationsschrift beschäftigt haben, richten. Dort haben Sie Westdeutschland und Frankreich verglichen. Wie haben sich Hochhaussiedlungen, die für die sogenannte breite Bevölkerung gedacht waren und dabei mit einer modernen Idee verbunden waren, ich zitiere jetzt einmal aus Ihrer Arbeit, zu „Arenen urbaner Marginalisierung“ entwickelt? Wie ist es zu dieser Konnotation der Wohnviertel gekommen, vor allem weil sich die Spuren dessen in dem Begriff der „Problemviertel“ ja bis heute finden, wann ist das passiert?
Fairerweise habe ich mich in meiner Arbeit vor allen Dingen mit dem Ruf von Vierteln und mit Debatten über urbanes Wohnen und wer wo wohnt beschäftigt. Ursprünglich mit dem Interesse, zu erfahren, was wann als gesellschaftliches Problem definiert oder auch welche Gruppen als gesellschaftliches Problem definiert werden. In dem Zusammenhang habe ich mich viel mit Hochhaussiedlungen befasst, weil Hochhaussiedlungen, wie sie seit den 50er und 60er Jahren verschärft gebaut worden sind, hoch utopische Projekte gewesen sind. Formen des Neubaus, in die sehr viel Hoffnung auf gesellschaftliche Veränderung und gesellschaftlichen Fortschritt gesetzt wurden, die aber schnell den Ruf erhalten, schlechte Viertel zu sein. Urbane Problemzonen, bald auch Räume der Marginalisierung. Das ist nicht nur im westdeutschen Fall so, sondern in sehr vielen europäischen, vor allen Dingen westeuropäischen Kontexten. Im osteuropäischen Kontext sieht das ein bisschen anders aus.
Deutschland und Frankreich sind sich in der Beziehung in vielerlei Hinsicht ähnlich im Verlauf der Diskussionen. Es gibt die Zeit der großen Wohnungsnot, direkt im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg, die zugleich eine Zeit der großen Hoffnung auf modernen Städtebau ist, der nach bestimmten Maximen die Stadt ganz grundsätzlich umbaut und verändert. Damit einher geht eine große Zukunfts-/Fortschrittshoffnung. Die Großsiedlungen, die entstehen, sind Siedlungen, in die ursprünglich viel Hoffnung gesetzt wird. Nicht nur weil sie Wohnraum schaffen sollen, sondern weil sie nicht im schlechten Sinne am Stadtrand gedacht sind, sondern als Wohnungen im Grünen für die viel mehr Platz da ist, die in der Nähe von Wäldern und Landschaften sind. Die sollen es ermöglichen aus der Stadt rauszukommen. Wohnungen, die insofern mit dem Versprechen auf mehr Sonne, mehr Grün, mehr Luft erbaut werden. In einer Zeit, in der auch Wohnraum für sehr viele oft noch keinen modernen Komfort geboten hat wie zum Beispiel eine Toilette auf dem Hof, keine oder schlechte Sanitäranlagen. Diese Wohnungen haben für viele eine Aufstiegserfahrung bedeutet.
Wohnungen in Großsiedlungen waren ursprünglich für viele Gruppen sehr begehrt, weil es helle, schöne, gut ausgestattete Wohnungen waren. Das heißt, Großsiedlungen haben ein Versprechen auf bessere, modernere, schönere Wohnungen für viele geboten und wurden am Anfang eher von Gruppen wie Angestellten, Arbeitern oder Arbeiterfamilien mit mehr Geld als von wirklich einkommensschwachen oder richtig einkommensschwachen Gruppen genutzt. Die ziehen dahin, aber binnen kürzester Zeit verändert sich der Ruf sehr vieler Großsiedlungen sehr schnell. Das hat unterschiedliche Gründe. In Teilen hängt es damit zusammen, dass sie unglaublich schlecht angebunden sind, man kommt oft nicht gut hin und sie sind unübersichtlich. Je nach Großsiedlung kann man die Erfahrung schnell machen, wenn man hinfährt, man orientiert sich da nicht besonders gut, weil die komisch verschachtelt und miteinander verbaut sind. Es ist so, dass sie groß und dunkel sind und dass die Hoffnung auf das Wohnen im Grünen nicht stattfindet, weil zum Beispiel die Grünflächen zwischen Hochhäusern als geteilter Wohnraum nicht funktionieren. Für viele, die von außen hinkommen und erst mal ein bisschen desorientiert in der Hochhaussiedlungswüste stehen, sind das keine schönen Wohnräume. Das deckt sich nicht notwendigerweise mit dem, was die anfänglichen Bewohnerinnen und Bewohner erfahren haben, aber mit dem, was externe Beobachterinnen und Beobachter dort gesehen haben. In bestimmten Großsiedlungen ist der Anteil an Sozialhilfeempfänger:innen und Leuten, die aus Obdachlosensiedlungen umgesetzt werden, gar nicht so gering. Das sind nur bestimmte, in Westberlin zum Beispiel das Märkische Viertel. Da fahren Beobachter und Beobachterinnen auch gerne hin, um zu erfahren, wie die unteren Schichten wohnen. Die unteren Schichten wohnen da nur bedingt, das sind sehr soziale gemischte Siedlungen, das ist Teil ihres Konzepts. Es entwickelt sich aus unterschiedlichen Gründen eine massive Diskussion zu diesen Vierteln als schlechten Viertel, als entseelte, als unschöne, als irgendwie kalte Viertel. In den 70er Jahren verknüpft sich das damit, dass immer mehr Gruppen, die es sich leisten können, aus diesen Großsiedlungen rausziehen. Viele, die in Einfamilienhäuser ziehen, ein paar, die aus unterschiedlichen Gründen in innerstädtische Altbaugebiete ziehen. Das heißt, eine bestimmte Gruppe, die am Anfang reingezogen ist, zieht raus. Es werden immer mehr Leute in diese Viertel umgesetzt. Der schon länger schlechte Ruf, der dazu beiträgt, dass Leute schneller rausziehen, geht einher mit wachsenden sozialen Problemen. Keinesfalls in allen, aber in ein paar dieser Großsiedlungen. Wenn es um Hochhaussiedlungen geht, gibt es wachsende Probleme, die nicht vor, sondern hinter dem schlechten Ruf liegen, ihn aber verstärken.
Das heißt, das politische Ziel war die verstärkte Teilhabe und die Durchmischung von mehr Teilen der Bevölkerung an einem gesellschaftlichen Leben, was auch heute in der Wohnungspolitik weiterhin ein Ziel ist. Würden Sie sagen anfangs war das noch so oder zumindest stärker und dann hat in einer Wechselwirkung zwischen dem öffentlichen Bild, der Berichterstattung und dem, was tatsächlich vor Ort passiert ist, eine Segregation stattgefunden?
In der Tendenz sind die Hochhaussiedlungen weniger sozial durchmischt als sie es mal waren, ganz klar. Insgesamt haben soziale Segregationsprozesse zugenommen seit zum Beispiel den 60er/70er Jahren. Es gibt mehr Probleme mit vor allen Dingen Wohnen am Stadtrand. Das hängt auch mit gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen zusammen für Gruppen, die auch stärker Probleme haben in Arbeitsmärkte reinzukommen. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch immer Bereiche gibt, wo weiter eine soziale Durchmischung stattfindet. Dieses Mischungskonzept hat politisch eine sehr andere Geschichte, wenn es um sogenannte ethnische oder soziale Durchmischung geht. Das, was in politischen Diskussionen lange im Vordergrund gestanden hat, war in den letzten Jahrzehnten nicht die soziale, sondern die ethnische Durchmischung.
So blöd der Satz ist, es ist komplex. Es gibt einerseits eine Geschichte von Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt, die bestimmte Gruppen stärker trifft, oft als migrantisch verstandene Gruppen, die deswegen nur in bestimmte Viertel ziehen konnten. Dort haben sie oftmals eher teureren Wohnraum als der Durchschnitt bekommen. In der Tendenz haben migrantische Familien sehr lange höhere Mieten im Schnitt als andere Gruppen gezahlt, was auch mit Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt zu tun hat. Das andere ist diese Pauschalproblematisierung von „Ausländervierteln“, sogenannten ethischen Kolonien oder welches Label Leute auch immer benutzen wollen. Das hat wiederum auch seine Probleme, weil das nicht per se problematische Viertel sind. Manchmal gibt oder hat es Solidaritäts- und Communitystrukturen gegeben, die durchaus stabil sind und überhaupt nicht notwendigerweise Problemviertel sind. Wenn man sagt, für mich ist ein Problemviertel eins mit hoher Kriminalitätsrate, sehr hohem Anteil an Armut, hohem Anteil an Vandalismus, dann trifft es gar nicht immer auf Viertel zu, die als ethnisch nicht genug durchmischte Viertel gelesen wurden. Das heißt, dass es sicherlich Sinn macht, weiterhin zu sehen, wie Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt funktioniert. Jedoch ohne in eine Generalproblematisierung von Vierteln zu verfallen, die als irgendwie ethnische Viertel gesehen werden. Je nachdem, um welchen Problemzusammenhang es geht, müsste man überlegen, um welche Pfadabhängigkeiten es gehen soll und dementsprechend aber auch um welche Instrumente.
Sie haben schon die Community und teilweise Nachbarschaftsdinge in bestimmten Vierteln angesprochen. Da würde ich gerne den Blick drauf richten, da mein Eindruck ist, bestimmte, Sie haben es schon gesagt, Altbauviertel erleben grundsätzlich eine große Renaissance, sozusagen je älter der Holzboden desto besser. Da steigen die Mieten. Ich habe das Gefühl, dass mit dieser Renaissance von bestimmten Bauten eine Idee von Gemeinschaftlichkeit, Nachbarschaftlichkeit einhergeht, die vielleicht früher bestimmten Stadtteilen, sozusagen die Dorfgemeinschaft, eher zugeschrieben wurde. Welche Parallelen sehen Sie da zu Diskussionen, die es schon in den 70er Jahren gab und wie erklären Sie sich, wo dieser nostalgische Blick auf eine bestimmte Gemeinschaftsstruktur herkommt?
Ich glaube, man kann das nicht nur vergleichen, sondern es gibt eine Entwicklung, die in den 70er Jahren grob anfängt und bis heute durchläuft. Nehme ich diese Aufwertung innerstädtischer Altbauviertel, die einsetzt, gibt es sehr schöne historische Studien, die sich genauer angucken, wer in diese ursprünglich in der modernistischen Stadtplanung als Abrissviertel deklarierten Viertel beginnt zu ziehen und ganz anders zu bewohnen. Je nach Land, in das man guckt, ob das nun Länder sind, die eher auf Eigenheim setzen oder mehr Miethausstrukturen haben wie Deutschland, indem sie die billig aufkaufen und anfangen zu sanieren oder indem sie sie entweder besetzen oder schlicht zur Miete darin wohnen und eine Wertschätzung von historischen Gebäuden dort leben und einfließen lassen.
In Teilen gibt es Überlappungen mit einem linksalternativen Milieu, das ohnehin eine hohe Wertschätzung von Solidarität hat und übrigens auch ein dörfliches Ideal, sozusagen ein Stadtteilsdorf, in dem wir alle zusammenwohnen, mit reinträgt. Das sind nicht nur, aber massiv, diejenigen, die wie Pioniere in diese Viertel reingehen. Tatsächlich ist dieses Wiederentdecken und Feiern von historischen Gebäudestrukturen, das um sich greift, nicht nur ein deutsches oder europäisches Phänomen, sondern es trägt sich sehr weit. Diese Feier von Gemeinschaftlichkeit ist im linksalternativen Milieu der Zeit ohnehin stark verhaftet, ist aber auch eine Gegenbewegung zum modernistischen Wohnen, das als kalt und vereinzelnd empfunden wird. In der Zeit, die de facto Individualisierungstendenzen hat, es gibt zum Beispiel einen steigenden Anteil von Singlewohnungen, Singlehaushalten in genau diesem Zeitraum. Es gibt noch mal eine stärkere Auflösung von klassischen Familienstrukturen und soziale Entwicklungen, die man als vereinzelnde Entwicklungen lesen kann. Insofern kommen mehrere Sachen zusammen, die dazu führen, dass in diesen Vierteln, auch als gesellschaftliche Gegenbewegung zur modernistischen Stadtplanung oder als alternativer Lebensstil gelesenem Stilmilieu, die Forderung nach Gemeinschaftlichkeit und Nachbarschaftlichkeit stark artikuliert wird.
Damit sind wir an einem guten Punkt, an dem ich gerne den Blick nach vorne in die Zukunft richten möchte. Sie haben es gerade gesagt: Es braucht andere Modelle für den Umgang mit dem Besitz von Wohnungen. Die politische Diskussion erinnert daran, ob das Einfamilienhaus mit Garten noch möglich ist, wie gesagt auch mit Blick auf den Klimawandel. Das war keineswegs nur eine soziale Frage. Die Idee, möglichst viel individuellen Wohnraum zu haben, steht immer stärker zur Debatte. Das heißt, bestimmte Ideen, die als sehr modern galten historisch sind für das zukünftige Wohnen nur noch bedingt zu benutzen. Trotzdem, was glauben Sie, auf welche historischen Ideen könnte man für das zukünftige Wohnen zurückgreifen? Oder was müsste sich grundsätzlich ändern?
Man muss sagen, dass dieser Drang zum Einfamilienhaus, Flächenversiegelung haben vorhin Sie auch als Stichwort, glaube ich, genannt, also sozusagen einige Probleme mit sich bringt, die aus Klimawandelsicht de facto große Probleme sind. Die immer weiteren Ausschreibungen von Flächen, die dann wiederum eigene infrastrukturelle Herausforderungen mit sich bringen. Wie kommt man vom Außen der Stadt ins Innen der Stadt wenn man dort arbeitet etc. Das ist eine Entwicklung, bei der es Sinn macht, über Alternativen nachzudenken. Zugleich muss man sich wahrscheinlich der Frage stellen, wie man damit umgeht, dass das für viele anscheinend das Wohnideal zu sein scheint. Ich habe aber noch keinen Ausweg aus dem Widerspruch gefunden, den ich durchaus als Widerspruch empfinde und der auch historisch ein Widerspruch gewesen ist. Es gibt einen hohen Anteil an Menschen, die gerne in einem Einfamilienhaus wohnen wollen. Das ist ein Widerspruch, auch das kann man historisch sagen, zur modernistischen Stadtplanung, viel gescholten für lange Zeit, denn die hat gar nicht so stark auf das Einfamilienhaus gesetzt als Wohneinheit, sondern unter anderem auf Hochhaussiedlungen. Ein Teil der Gründe, warum die Hochhaussiedlung nicht funktioniert haben, war, dass Leute rausgezogen sind, um, sofern sie es irgendwie finanzieren konnten, ins Einfamilienhaus zu ziehen.
Dann zum Abschluss, wenn Sie utopisch in die Zukunft gucken könnten, meinen Sie, wir werden noch erleben, wie sich bestimmte Grenzen auflösen in Bezug auf das Wohnen?
Ich hoffe, im Moment bin ich eher frustriert, aber auch das ist mehr ein politisches Statement als eine wissenschaftliche Einschätzung. Meine Frage ist oder meine Frustration rührt daher, dass ich glaube, dass viele Leute Probleme und Widersprüche sehen, aber aus unterschiedlichen Gründen, und die Beharrungskraft bestehender politischer und ökonomischer Modelle enorm ist. Das könnte man für den Klimawandel noch ganz anders ausführen, aber für das Wohnen und Ungleichheit im Wohnen gilt das auch. Ich glaube, dass durchaus nicht wenige die Probleme sehen: steigende Kosten im Wohnen, Mietsteigerungen, damit einhergehende Ungleichheiten, die durchaus bemerkenswert sind. Aber die Widerstände gegen die doch sehr vielen Versuche, daran was zu ändern, sind bemerkenswert. Ich hoffe, dass wir eine Veränderung sehen, die nicht allein aus den wachsenden Problemen resultiert, sondern auch aus der Bereitschaft, sie früh genug in Angriff zu nehmen. Wie zuversichtlich ich bin, variiert von Tag zu Tag. Ich würde sagen, so mittel zuversichtlich.
Es bleibt definitiv eine aktuelle Frage. Dass die Fragen rund um das Wohnen sich in unserer Generation so lösen, dass man sagt, jetzt braucht man darüber nicht mehr groß zu diskutieren, halte ich für ausgeschlossen.
Ja, da stimme ich Ihnen zu.
Vielen Dank für Ihre Zeit und das spannende Gespräch und die Einblicke in die Entwicklungen, vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch, ich bedanke mich auch bei Ihnen, vielen Dank.
Gabriele Woidelko: Das war unser History and Politics Podcast mit Christiane Reinecke zu den historischen Entwicklungen des Wohnens. Weiterführende Links finden Sie in den Shownotes und auf unserer Website, wo Sie auch das Manuskript zur Folge nachlesen können.
Weitere Informationen zu den Aktivitäten des Bereichs Geschichte und Politik der Körber-Stiftung finden Sie auf unserer Stiftungswebsite. Da gibt’s natürlich auch alle weiteren Folgen unseres History and Politics Podcasts.
Wenn Sie Fragen, oder Anregungen zu unserem Podcast haben, schreiben sie uns gerne eine Email an gp@koerber-stiftung.de.
Vielen Dank fürs Zuhören, hoffentlich bis zur nächsten Folge, machen Sie es gut!

Geschichte ist Gegenwart! Der History & Politics Podcast der Körber-Stiftung
Warum Geschichte immer Gegenwart ist, besprechen wir mit unseren Gästen im History & Politics Podcast. Wir zeigen, wie uns die Geschichte hilft, die Gegenwart besser zu verstehen.
-
Is Globalization unstoppable? Insights from the Past#73 38 min. 12. Jun 2024
-
Moldau: Perspektiven eines zerrissenen Landes#66 35 min. 7. May 2024
-
The New Germany S03E06: Extremism: Defending Democracy in Past and Present#72 50 min. 9. Apr 2024
-
Über die Geschichte einer gewaltfreien Gesellschaft#71 45 min. 2. Apr 2024
-
The New Germany S03E05: Social Transformation: What is German?#70 53 min. 26. Mar 2024
-
The New Germany, S03E04: Made in Germany: Industry and Deindustrialisation#69 49 min. 12. Mar 2024
-
History in the Age of Disinformation#68 51 min. 5. Mar 2024
-
The New Germany, S03E03: Germany and the US: Cowboys and Keynesians#67 51 min. 27. Feb 2024
-
Distance and emotion: Ukrainian historians in war times#65 53 min. 20. Feb 2024
-
The New Germany, Season 3 - Episode 2: Germany and France: A Marriage on the Rocks#64 56 min. 13. Feb 2024
-
The New Germany, Season 3 - Episode 1: Crisis Chancellors#63 55 min. 30. Jan 2024
-
Technologien gegen das Vergessen#62 36 min. 27. Jan 2024
-
Amerika – das Ende eines Traums?#61 64 min. 12. Dec 2023
-
The New Germany, S02E07: Grenzen überwunden? Das Verhältnis zwischen Ost und West#60 84 min. 14. Nov 2023
-
Zwischen Moral und Realpolitik: Das deutsch-israelische Verhältnis#59 46 min. 12. Sep 2023
-
Chatting with the Past#58 47 min. 8. Aug 2023
-
Die Arktis – Von der Friedenszone zur internationalen Konfliktzone#57 37 min. 4. Jul 2023
-
Zeitenwende and the Return of History#56 44 min. 8. Jun 2023
-
Polen und Europa seit 1989#55 33 min. 30. May 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 6: German Politics in Flux#54 43 min. 9. May 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 5: German Schuldenangst#53 46 min. 25. Apr 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 4: Germany’s Grand Strategy#51 48 min. 11. Apr 2023
-
Politik unter Einsatz des Körpers#52 42 min. 6. Apr 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 3: Germany and Poland#49 47 min. 28. Mar 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 2: Germany and China#48 51 min. 14. Mar 2023
-
Das Jahr 1923 und German Schuldenangst#47 40 min. 7. Mar 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 1: Germany’s Russians#46 54 min. 28. Feb 2023
-
Rechte Geschichtsbilder im Video-Gaming#45 47 min. 15. Feb 2023
-
Asylpolitik: Eine Konfliktgeschichte#44 32 min. 12. Jan 2023
-
Aktivist:innen in Russland: Zwischen Untergrund und Friedensnobelpreis#43 35 min. 6. Dec 2022
-
Das Ringen um die neue Weltordnung#42 43 min. 21. Nov 2022
-
Ukraine: Eine Nation unter Beschuss#41 45 min. 21. Oct 2022
-
Wohnen – wo Privates politisch ist#40 32 min. 6. Sep 2022
-
The New Germany, Part 4: The Lid of History#39 52 min. 22. Aug 2022
-
The New Germany, Part 3: German Energy Policy and Russian Gas#38 43 min. 8. Aug 2022
-
The New Germany, Part 2: A Love-Hate Relationship#36 57 min. 25. Jul 2022
-
Russia: When History Becomes a Weapon (Englische Folge)#34 40 min. 19. Jul 2022
-
The New Germany, Part 1: The Bundeswehr and Germany's Mindset#35 42 min. 12. Jul 2022
-
Erinnerung hat Konfliktpotenzial – Wie sich unser Blick auf Geschichte ändert#33 48 min. 7. Jun 2022
-
Krieg in der Ukraine: ein historischer Wendepunkt?#32 35 min. 31. May 2022
-
Geschichte und Erinnerung in Games#31 28 min. 3. May 2022
-
Belarus: Was bleibt von den Protesten 2020?#30 30 min. 8. Mar 2022
-
Sind Russland und China heute Imperien?#29 39 min. 8. Feb 2022
-
#30PostSovietYears: Kann Kunst versöhnen?#28 39 min. 30. Nov 2021
-
China – Modernisierung zwischen Isolation und Öffnung#27 39 min. 28. Oct 2021
-
Deutschland und Polen - Geschichte und Zukunft einer guten Nachbarschaft#26 42 min. 23. Sep 2021
-
Russland - Großmacht mit historisch gewachsenem Sonderstatus?#25 33 min. 24. Jun 2021
-
Belarus – Über Proteste, Demokratie und Diaspora#24 39 min. 29. Apr 2021
-
Die Vorgeschichte der Hohenzollern-Debatte. Adel, Nationalsozialismus und Mythenbildung nach 1945.#23 54 min. 25. Mar 2021
-
Jüdisches Leben in Deutschland seit 1945#20 50 min. 25. Feb 2021
-
Deutschland und Frankreich – Fremde Freunde?#22 40 min. 27. Jan 2021
-
Geschichtsvermittlung ist eine Zukunftsbranche#21 27 min. 17. Dec 2020
-
Tatjana Tönsmeyer: Das europäische Erbe der NS-Besatzungsherrschaft#19 34 min. 26. Nov 2020
-
Natasha A. Kelly: Rassismus und die Geschichte Schwarzer Menschen in Deutschland#18 40 min. 19. Oct 2020
-
Sandra Günter: Sport macht Gesellschaft?#17 37 min. 24. Sep 2020
-
Stefanie Middendorf: Geschichte der Staatsverschuldung: Kredite für die öffentliche Hand#16 40 min. 27. Aug 2020
-
Helene von Bismarck: Großbritannien und die EU – ein historisches Missverständnis?#15 34 min. 27. Jul 2020
-
Aleida Assmann: Was hält Europas Sterne zusammen?#14 24 min. 25. Jun 2020
-
Birte Förster: Rolle rückwärts bei der Gleichberechtigung?#13 29 min. 8. Jun 2020
-
Till van Rahden: Demokratie in Krisenzeiten#12 30 min. 6. May 2020
-
Elke Gryglewski: Alles gesagt, alles gezeigt?#11 23 min. 17. Apr 2020
-
Frank Uekoetter: Pandemien und Politik#10 25 min. 27. Mar 2020
-
Mary Elise Sarotte: Die NATO-Osterweiterung.#9 29 min. 20. Nov 2019
-
Werner Plumpe: Die Kraft des Kapitalismus.#8 21 min. 23. Oct 2019
-
Ilko-Sascha Kowalczuk: 30 Jahre Mauerfall – und nun?#7 23 min. 1. Oct 2019
-
Claudia Weber: Kriegsausbruch 1939#6 24 min. 11. Jul 2019
-
Jason Stanley: Faschismus damals und heute#5 18 min. 4. Jul 2019
-
Philip Murphy: Rule Britannia?#4 24 min. 27. Jun 2019
-
Hedwig Richter: Volksbegehren oder Staatsgewalt?#3 22 min. 20. Jun 2019
-
David Ranan: Israelkritik und Antisemitismus#2 22 min. 13. Jun 2019
-
Eckart Conze: Von Versailles 1919 zu den „Neuen Kriegen“#1 28 min. 28. May 2019