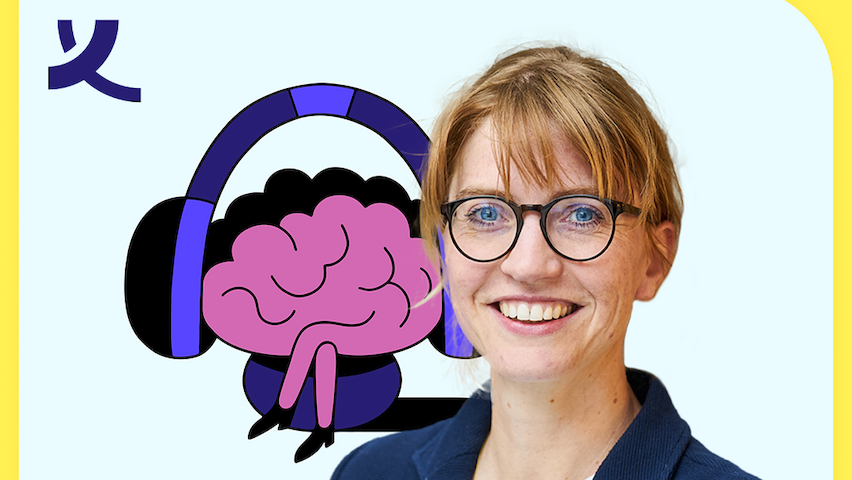Till van Rahden: Demokratie in Krisenzeiten
Geschichte ist Gegenwart! Der History & Politics Podcast der Körber-Stiftung
Wie die Deutschen nach 1945 Freiheit lernten
Die Corona-Pandemie fordert uns als Gesellschaft heraus. Gibt es noch genug Raum für Streit, für die Auseinandersetzung mit abweichenden Meinungen? Wie ist es um das Vertrauen zwischen Regierung und Regierten bestellt? Und welche Rolle spielt das demokratische Grundvertrauen, das nach 1945 entstehen konnte, in der aktuellen Krise? Darüber spricht Gabriele Woidelko mit dem Historiker Till van Rahden von der Universität Montreal im Podcast History and Politics der Körber-Stiftung.
„Und das heißt dann konkret, dass wir nicht gedankenlos alles wieder öffnen, aber genau überlegen sollten: Welche Formen von bürgerlicher Geselligkeit im öffentlichen Raum können wir bei physischer Distanz schon heute wieder ermöglichen?“
Till van Rahden, Historiker
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von History and Politics, dem Podcast der Körber-Stiftung zu Geschichte und Politik. In jeder Folge sprechen wir mit einem Gast über ein aktuelles politisches oder gesellschaftliches Thema. Dabei interessiert uns besonders, wie uns die Vergangenheit dabei helfen kann, Antworten auf Fragen der Gegenwart zu finden.
In dieser Folge geht es um die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf unsere demokratische Gesellschaft. Und um die Frage, welchen Beitrag das demokratische Grundvertrauen, das in Deutschland seit 1945 entstehen konnte, zur Bewältigung der aktuellen Krise leisten kann. Ich bin Gabriele Woidelko und freue mich, dass Sie zuhören.
Seit Wochen ist zu spüren, dass die Corona-Pandemie nicht nur eine Herausforderung für unser Gesundheitswesen ist, sondern dass sie uns auch in unserem gesellschaftlichen Miteinander fordert. Bleibt dabei noch genug Raum für den Streit, für die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Meinungen und Positionen? Wie viel Vertrauen ist zwischen Regierenden und Regierten notwendig? Wie kann, soll und muss die Gesellschaft einbezogen werden in die politische Entscheidungsfindung über die Wiederbelebung des öffentlichen Lebens? Und was verdeutlicht dabei der Blick in die Geschichte?
Darüber habe ich mit dem Historiker Till van Rahden gesprochen, der an der Universität Montreal Deutschland- und Europastudien lehrt. Sein aktuelles Buch »Demokratie – eine gefährdete Lebensform« ist im vergangenen Jahr erschienen.
Gabriele Woidelko: Herr van Rahden, unser Gespräch findet in sehr außergewöhnlichen Zeiten und unter durchaus außergewöhnlichen Umständen statt: Wir befinden uns mitten in der Corona-Pandemie, wir erleben Kontaktbeschränkungen, wir sind in unserem Bewegungsradius eingeschränkt. Es gelten Abstands- und Hygienevorschriften und auch einige demokratische Grundrechte, wie zum Beispiel die Versammlungsfreiheit, sind vorübergehend außer Kraft gesetzt. Im Vergleich denke ich aber doch, dass Deutschland ein Land zu sein scheint, das mit der Corona-Pandemie ganz gut umgehen kann. Es gibt immer noch eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung für die Maßnahmen. Ist das Ihrer Ansicht nach auch ein Zeichen dafür, wie gefestigt die Demokratie bei uns in Deutschland ist?
Till van Rahden: Also ich würde zunächst einmal darauf hinweisen, dass die Bundesrepublik Deutschland großes Glück hatte, weil andere Länder, andere europäische Länder wie Italien oder Spanien, vorher schon mit dem Virus zu kämpfen hatten und hier eben eine Art Vorlaufzeit war, um sich Gedanken darüber zu machen, welche Maßnahmen sinnvoll, welche Maßnahmen möglich sind. Ich glaube, eine der Besonderheiten ist sicherlich der ausgeprägte Föderalismus: Dass die erste Verantwortung häufig bei den Kommunen und Gemeinden lag, dann die Länder eine zentrale Rolle gespielt haben und die Bundesregierung häufig nur koordinieren konnte. In der Summe hat das, glaube ich, die Akzeptanz vieler Maßnahmen gestärkt, weil die Leute das Gefühl hatten, dass da nicht irgendwo fern im Bundeskanzleramt in Berlin entschieden wird, sondern in den Städten selbst die entscheidenden Weichen gestellt werden, um der Pandemie zu begegnen.
Aber das war ja nicht selbstverständlich…
Nein. Ich glaube, dass eine der interessanten Phänomene der jetzigen Situation ja darin besteht, dass viele – ich formuliere es etwas flapsig – populistische Positionen plötzlich weniger überzeugend wirken. Und dass etablierte staatliche Organe, egal ob das jetzt auf Landes-, Bundesebene oder kommunaler Ebene ist, viel Vertrauen genießen. Und das ist etwas, was mit Sicherheit über viele Jahrzehnte gewachsen ist und nicht einfach – in Anführungszeichen – vom Himmel fällt.
Das heißt, wenn wir jetzt auf die bundesdeutsche Geschichte gucken, auf die Geschichte nach 1945: Wir mussten uns das auch ein bisschen erarbeiten?
Ja, ich glaube, das Wort »wir« ist in dem Zusammenhang ganz wichtig, weil das Entscheidende für den Erfolg vieler politischer Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie ist, dass die Bürgerinnen und Bürger fast freiwillig bereit sind, diese Maßnahmen mitzutragen. Also in dem Moment, wo der Staat all diese Regeln mit Zwang durchsetzen müsste, wäre schon viel verloren, und zwar nicht nur an Freiheit, sondern auch an Wirksamkeit dieser Maßnahmen. Das heißt, das, was man so eine Art demokratisches Grundvertrauen nennen könnte, spielt hier eine zentrale Rolle.
Lassen Sie uns nochmal ein bisschen zurück gucken auf die Zeit seit 1945. Sie sprechen vom demokratischen Grundvertrauen – woher kommt das, dieses demokratische Grundvertrauen hier in Deutschland?
Also das Erste, was man vielleicht nochmal unterstreichen muss, ist, dass die breite Öffentlichkeit in der unmittelbaren Nachkriegszeit die demokratische Herrschaftsform als etwas angesehen hat, was gleichsam durch die Alliierten verordnet und erzwungen worden war. Und alle Umfragen aus den fünfziger Jahren deuten darauf hin, dass es nicht ein Land war, in dem die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger gleichsam Herzensdemokraten waren. Da hat sich viel verschoben. Offensichtlich sind das aber Dinge, die sich auch nicht nur im Laufe der Zeit verschieben können. Das Interessante daran scheint mir zu sein, dass eine Demokratie immer – und wenn man so will jeden Tag – neu aufgefordert ist, dieses Vertrauen zu pflegen und neu zu gewinnen. Und dass das nicht eine Frage danach ist, ob wir heute bessere Menschen sind als die Männer und Frauen in der frühen Bundesrepublik.
Sie sagen, Demokratie muss dieses Vertrauen gewinnen. Können Sie mal beschreiben, wer da eigentlich welche Rolle hat? Also wer muss was tun, damit dieses Vertrauen sich festigen kann?
Also es gibt natürlich auch die Frage, welchen Führungsstil politische Eliten in einer Demokratie pflegen müssen, um die demokratische Kultur nicht zu beschädigen. Aber der aus meiner Sicht entscheidende Punkt ist, dass die Bürgerinnen und Bürger sich selbst als mündige Subjekte in einer Gesellschaft von Freien und Gleichen begreifen müssen. Und diese Haltung ist eben etwas, was nicht vom Himmel fällt, sondern was immer wieder neu gepflegt und kultiviert und neu auch wieder gewonnen werden muss. Was Mündigkeit heute bedeutet, ist mit Sicherheit etwas anderes, als es in den in den späten fünfziger Jahren war. Und was es in fünfzig Jahren sein wird, können wir überhaupt nicht beurteilen.
Wenn wir in die Geschichte der Bundesrepublik schauen, dann gelten die späten sechziger Jahre als eine wichtige Zäsur. Vor allem, was die Entwicklung von Mündigkeit und eines demokratischen Selbstverständnisses angeht. Welche Rolle würden Sie den späten sechziger Jahren und den Emanzipationsbewegungen der damaligen Zeit für das zusprechen, was Sie Demokratie als Lebensform nennen?
Ich würde zunächst einmal betonen, wie weit zurück das Nachdenken über die Frage der Mündigkeit reicht. Das heißt, in dem Moment, wo es eine Emanzipation gibt – von einer göttlichen Ordnung, einer kirchlichen Hierarchie –, in dem Moment stellt sich eben die Frage: Was heißt Mündigkeit eigentlich? Und da gibt es diese berühmte Antwort Kants. Also die Fähigkeit, sich seines Verstandes ohne die Hilfe von anderen zu bedienen, und das ist eben etwas, was für die gesamte – und das ist noch nicht unbedingt eine demokratische Staatstheorie, aber zumindest die liberale, republikanische Staatstheorie – grundlegend ist. Weil Herrschaft eben nur noch legitim ist, wenn sie auf freiwilliger Zustimmung beruht. Freiwillige Zustimmung ist eben etwas, was die mündige Reflexion darüber, ob ich zustimmen möchte oder nicht, voraussetzt. Und das ist eine Frage, in der spielt '68 eine große Rolle, aber es ist keine Frage, die die Achtundsechziger erfunden haben.
Die Achtundsechziger haben die Frage nochmal neu aufgegriffen, würden Sie sagen?
Sie haben die Frage mit Sicherheit auf eine gewisse Art und Weise auch nochmal zugespitzt. Sie haben viele erstarrte Konventionen verflüssigt oder manche autoritären Verhältnisse – in Anführungszeichen – zum Tanzen gebracht. Aber die grundsätzliche Frage ist viel älter. An manchen Punkten beginnt 1968 auch eine Suche nach einer Gesellschaft ganz ohne Autorität und ganz ohne Herrschaft. Das ist dann eine Debatte, die verbinden wir mit dem Begriff des Antiautoritären und das ist sehr spezifisch für Achtundsechzig. Weil die Debatte vorher und vielleicht auch unsere heutige Debatte eher nicht davon lebt, ob wir Herrschaft und Autorität ganz überwinden wollen, sondern was eine spezifisch demokratische Form von Herrschaft ist und was eine spezifische, demokratische Form von Autorität ist.
Und hinzu kommt ja auch, wenn wir über '68 sprechen und über Deutschland, dann müssen wir natürlich auch über die DDR sprechen, wo die Auseinandersetzung mit dem Autoritären ein bisschen anders verlaufen ist.
Der Aspekt ist ganz wichtig und gleichzeitig sollten wir aber auch daran erinnern – das wird bei den deutsch-deutschen Debatten häufig vergessen –, dass die Bürgerrechtsbewegung in den kommunistischen Volksdemokratien, und wie sie sich selbst verstanden haben, häufig etwas war, was eben nicht so sehr auf Deutschland beschränkt war, sondern dass der Ideenaustausch zwischen der Tschechoslowakei, Polen, Ungarn und der DDR dafür viel wichtiger war. Und dass es eben so eine Art von demokratietheoretischer Reflexion gab, die für diese Bürgerrechtsbewegung typisch war und die dann auch in der DDR eine zentrale Rolle gespielt hat. Um es um es etwas plakativ zu machen: Vaclav Havel war für die DDR-Bürgerrechtsbewegung mit Sicherheit wichtiger als irgendein führender Demokratietheoretiker aus Westdeutschland. Es gibt auf jeden Fall ausgeprägte Asymmetrien. Wenn Sie mit klugen Leuten in Prag, Budapest oder Warschau, Krakau, Breslau oder auch in den baltischen Staaten diskutieren oder auch mit russischen Intellektuellen, liegt es auf der Hand: Die kennen die westlichen – in Anführungszeichen – Debatten über die liberale Demokratie genau, und wir wissen eigentlich wenig von den ost- und mitteleuropäischen Debatten. Das ist zumindest etwas, das man sich vor Augen führen sollte in all diesen Auseinandersetzungen.
Ihr aktuelles Buch beschäftigt sich mit Demokratie als gefährdeter Lebensform. Das klingt zumindest für mich so, als würden Sie der Demokratie noch Überlebenschancen einräumen und den Patienten nicht direkt für tot erklären. Können Sie erklären, was Sie meinen, wenn sie über »Demokratie als Lebensform« sprechen?
Also vielleicht darf ich damit einsteigen, dass im Kontext der politischen Bildung – also auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung und bei den Landeszentralen – diese Formel »Demokratie als Lebensform« gängig ist. Das Auffällige ist aber: Es wird nie ausbuchstabiert, was damit gemeint ist. Das ist die erste Beobachtung.
Die zweite wichtige Unterscheidung ist: Die Demokratie als Lebensform ist etwas Anderes als die Demokratie als Herrschaftsform oder als Staatsform. Demokratie als Herrschafts- und Staatsform ist etwas, was uns wohl vertraut ist: Freie Wahlen, Parlamentarismus, Gewaltenteilung, irgendeine Form von Konstitutionalismus, eventuell ein Parteiensystem – in welcher Art und Weise auch immer. Und das ist das, was wir dann eben mit der Demokratie als Herrschaftsform verbinden. Die Frage für mich ist: Woher kommt die Legitimität dieses Herrschaftssystems? Denn es ist natürlich ein Herrschaftssystem, was auch Zwangsgewalt ausüben kann und gelegentlich auch Zwangsgewalt ausübt. Diese Frage, woher die Zustimmung der mündigen Bürgerinnen und Bürger zu dieser Form der Herrschaft kommt, die versuche ich dann mit dem Begriff oder mit dem Bild der Demokratie als Lebensform zu beantworten. Das heißt, wenn Sie das ein bisschen weniger blumig formulieren wollen: Was mich interessiert, sind die kulturellen und sozialen Voraussetzungen, die die Demokratie als Herrschaftsform überhaupt möglich machen.
Ja ich hätte es gerne noch ein bisschen weniger blumig, ich hätte es gern sehr praktisch: Wenn Sie über Demokratie als Lebensform sprechen - was genau haben Sie im Kopf? Wenn ich Texte von Ihnen lese, dann habe ich oft den Eindruck, dass Sie jemand sind, der sich sehr für das Reale, für die Wirklichkeit interessiert. Also wo lebt die Demokratie denn, wenn Sie über Demokratie nachdenken?
Man kann sagen, Freiheit und Gleichheit sind Verfassungsprinzipien und dann fragt man sich ja, was heißt das jetzt eigentlich genau? Und da kann man sagen: Es gibt bürgerliche Freiheitsrechte. Aber das sind eben auch und nicht zuletzt sinnliche Erfahrungen. Wir erfahren uns als frei und gleich im Miteinander und Gegeneinander im öffentlichen Leben. Und das trifft dann zu für ganz verschiedene Orte. Wenn Sie das auf unseren Lebensweg übersetzen, dann können Sie sagen: Im Miteinander in der Familie oder in irgendwelchen familienähnlichen Konstellationen, im Miteinander im Kindergarten, im Miteinander auf dem Spielplatz, im Miteinander in den Schulen lernen wir eine bestimmte Haltung und machen bestimmte Erfahrungen von Freiheit und Gleichheit, die uns am Ende zu dem machen, was die Demokratie trägt – die mündigen Bürgerinnen und Bürger.
Also Sie reden dann über ganz konkrete Orte. Ich habe jetzt Spielplätze, Kindergarten, wahrscheinlich auch Sportplätze gehört – alles Orte, die in Zeiten der Kontaktbeschränkungen weitgehend verschlossen bleiben. Wie legitim finden Sie das?
Ich bin kein Virologe und kein Mediziner, aber ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn wir uns überlegen, welche Maßnahmen sinnvoll sind, dann ist das nicht nur eine Frage, die wir im Himmel der Abstraktion beantworten sollten. Sondern die wir immer auch vor dem Hintergrund der Tatsache beantworten sollten, dass wir in einer Demokratie leben. Das heißt, es gibt nicht irgendeine perfekte Lösung in der jetzigen Situation, die wir finden könnten, sondern im Suchen nach einer guten Lösung sollten wir uns immer vor Augen führen, dass das eine Lösung sein sollte, die einen demokratischen Geist atmet. Und das heißt dann konkret, dass wir nicht gedankenlos alles wieder öffnen, aber genau überlegen sollten: Welche Formen von bürgerlicher Geselligkeit im öffentlichen Raum können wir bei physischer Distanz schon heute wieder ermöglichen?
Das ist ja aber auch, wenn ich das richtig sehe, das, was momentan an vielen Stellen passiert. Also, würden Sie sagen, wir gehen als Demokratie, als demokratische Gesellschaft angemessen mit dieser Herausforderung um?
Die Demokratie lebt grundsätzlich immer vom Streit und insofern würde ich mir zunächst einmal auch mehr Streit über die Frage wünschen, welche Öffnungen wünschenswert und möglich sind. Und einen Streit, der nicht allein darauf zielt, was die ökonomischen Kosten sind, sondern der sich auch die Frage stellt: Was sind die politischen Kosten, die mit dieser Ausnahmesituation verbunden sind? Man müsste überlegen, welche Orte zum Beispiel in sozialen Brennpunkten besonders wichtig sind. Das sind Sportplätze, das sind eventuell Stadtbibliotheken oder zumindest Stadtteilbibliotheken und ob man nicht überlegen könnte – bei aller Distanz, also physischen Distanz –, manche dieser Orte wieder zu öffnen? Die Kosten, die dadurch entstehen, dass wir zu Hause bleiben müssen, die Kosten, die dadurch entstehen, dass Kindergärten und Schulen geschlossen sind, sind extrem ungleich verteilt. Das ist banal, aber es ist wichtig, das im Auge zu behalten. Und für die Frage, was Homeschooling bedeutet, macht es einen Unterschied, ob die Schule in einem Milieu ist, wo fast alle Eltern einen Computer oder mehrere Computer zuhause haben, oder, wie wir das wissen aus manchen Hauptschulen, ob dann vielleicht maximal ein oder zwei von insgesamt fünfundzwanzig, sechsundzwanzig Eltern überhaupt einen Computer haben. Ich glaube, dass wir da viel fantasievoller und – ich will nicht sagen mutiger, das ist immer so abgegriffen – auf jeden Fall fantasievoller der Frage nachgehen sollten: Wie gelingt es, ein höchstmögliches Maß an öffentlicher Geselligkeit zu ermöglichen, ohne auf physische Distanz zu verzichten?
Sie haben vorhin gesagt, dass Demokratie auch vom Streit und von der Auseinandersetzung lebt. Das wird ja momentan in den digitalen Zeiten ein bisschen schwieriger, wo wir überwiegend über Bildschirme und Mikrofone miteinander diskutieren, oder?
Ja, aber das betrifft nicht unbedingt nur die öffentliche Geselligkeit, sondern auch die private Geselligkeit im Freundeskreis, die nur sehr eingeschränkt möglich ist. Die natürlich auch ein Ort ist – das ist nicht die Öffentlichkeit im engeren Sinne –, wo man auch über öffentliche Fragen diskutiert und sich Gedanken macht, Anregungen mitnimmt und Fragen mitnimmt – und insofern ist auch das ein Verlust.
Die Corona-Pandemie kennt keine Grenzen, sie betrifft die ganze Welt. Auch in der Europäischen Union hat sie massive Auswirkungen - nicht nur in den einzelnen Mitgliedsstaaten, sondern auch für die EU als Gemeinschaft.Mit Till van Rahden habe ich auch darüber gesprochen, welche Gefahren aus der Pandemie für den Zusammenhalt in der EU und für die Akzeptanz der europäischen Gemeinschaft in der Bevölkerung entstehen.
Würden Sie sagen, dass die Corona-Pandemie auch ein Rückschritt sein könnte für Europa? Eine Rückkehr zum Nationalstaat?
Ich glaube, der erste Punkt ist, dass uns in den letzten zwei Monaten klar geworden ist, wie wichtig die Nationalstaaten innerhalb der Europäischen Union bis heute noch sind. Das waren sie auch vor der Corona-Krise, aber mit der Corona-Krise ist die Bedeutung der Nationalstaaten einfach augenscheinlich geworden. Was das mittelfristig bedeutet für die Europäische Union? Ich würde mir wünschen, dass es gelingt, in den nächsten Wochen und Monaten an entscheidenden Punkten – sowohl was die Zeichen angeht als auch was die praktische Politik angeht – die Weichen so zu setzen, dass dann am Ende doch der Eindruck entsteht, dass Europa zumindest nicht beschädigt aus dieser Krise hervorgeht. Einer der Gründe für die Skepsis gegenüber der Europäischen Union ist ja immer die Frage des Demokratiedefizits. Und in dem Moment, wo sozusagen autoritär-paternalistische Lösungen kommen – egal ob jetzt aus Berlin oder Brüssel –, ist das nichts, was diesen demokratischen Geist stärkt. Und ich glaube, die – wie soll ich das formulieren – Versuchung eines autoritären Technokratismus ist in dieser Krisensituation besonders hoch. Aber es ist eine Falle, in die Demokratien nicht gehen sollten. Weder auf der Ebene der Nationalstaaten noch auf der Ebene der Europäischen Union.
Das heißt, »autoritärer Technokratismus«, also Entscheidungen, die getroffen werden auf der Basis von Zahlen und Fakten, die dann verkündet werden, die nicht ausreichend diskutiert werden im demokratischen Miteinander…
Und auch die Versuchung, irgendwie die Dinge ganz schnell zu lösen. Natürlich gibt es Handlungszwänge, aber wir sind jetzt nicht mehr vor der Frage, ob wir die Schulen schließen oder nicht, oder die Museen oder die Stadtbibliothek, sondern wann wir sie wieder öffnen und unter welchen Umständen. Ich glaube, dass dafür irgendwie ein sorgfältiges, kluges Abwägen von unterschiedlichen Argumenten im Streit ganz wichtig sein wird, und zwar nicht nur, weil dann die Lösungen notwendigerweise besser sind, sondern weil es eben Lösungen sind, die demokratisch legitimiert sind. Das spielt ja auch eine entscheidende Rolle: In dem Moment wo die Bürgerinnen und Bürger, die im Moment noch darauf vertrauen, dass die Entscheidungen, die politischen Entscheidungen auf kommunaler Ebene, Landesebene, Bundesebene vernünftige Entscheidungen sind, wenn die das Vertrauen verlieren, dann wird es schwieriger, auf die Situation zu reagieren. Ich meine das ist die große Herausforderung für die Vereinigten Staaten zurzeit…
…dass Vertrauen in die Vernunft, in die vernünftigen Entscheidungen der Regierenden verloren gegangen ist?
Genau. Hier gibt es – nicht nur hier, sondern auch in Frankreich, in Italien und selbst in Großbritannien –eine Art parteiübergreifendes Vertrauen darin, dass die Entscheidungen, die politischen Entscheidungen, nicht völlig abwegig sind. Dieses Vertrauen spielt eine wichtige Rolle und dieses Vertrauen sollten wir eben hegen und pflegen – in Anführungszeichen. Und die Form, in der wir das tun können, ist eben der offene Streit über mögliche Wege, und nicht die schnelle Lösung.
Nun tun sich ja Historiker üblicherweise ein bisschen schwer mit Prognosen für die Zukunft. Sie haben aber eben mit Blick auf die Europäische Union schon mal anklingen lassen, was Sie sich wünschen. Ich würde Sie das gerne auch mit Blick auf Deutschland fragen: Was wünschen Sie sich denn für unser demokratisches Zusammenleben hier für die Zeit nach Corona?
Ich glaube, der erste Punkt ist, da bin ich mir ziemlich sicher: Wir werden alle ein erhöhtes Gespür dafür mitnehmen, wie zufällig manche Dinge sind. Und dass man eben Politik nicht irgendwie über dreißig, vierzig Jahre hinaus planen kann. Und dass das Improvisieren, das Experimentieren, dass das Reagieren auf ganz neue Situationen eben unser Zusammenleben kennzeichnet. Dann könnte man eben ergänzen, dass die Demokratie, weil sie kein festes politisches Programm hat, kein festes Repertoire an Maßnahmen oder Zielen, die sie durchsetzen will, eigentlich eine gute Art des Zusammenlebens ist, um sich mit dieser Unsicherheit einzurichten. Das ist aber allgemein formuliert. Und das Zweite ist – und da bin ich mir nicht ganz sicher –, aber das würde ich mir wünschen: Die ersten, zwei, drei, vielleicht sogar vier Nachkriegsjahrzehnte waren dadurch gekennzeichnet, dass in der europäischen Öffentlichkeit ein Bewusstsein dafür wach war, beziehungsweise wachgehalten wurde, wie unwahrscheinlich die liberale Demokratie ist. Wie sehr wir uns darum bemühen müssen, dass sie nicht ihre Fassung verliert, dass wir sie am Leben erhalten. Ich glaube, dass wir uns nach dem Ende des Kalten Krieges lange Zeit in einer Art Selbstgewissheit eingerichtet haben, dass die liberale Demokratie ja so etwas ist wie das selbstverständliche Ziel der Geschichte. Das ist, glaube ich, jetzt im Zuge dieser Krise auch nochmal brüchig geworden und brüchiger geworden, als es als es vorher schon war.
Ich würde mir erhoffen, dass bestimmte, einfach auch konkrete Dinge möglich werden, die auf dieses Problem zielen, dass wir diese Demokratie eben pflegen müssen und das fängt dann bei konkreten Sachen an, über die ja jetzt auch schon viel diskutiert wird: Was für eine Art von Gesundheitswesen brauchen wir eigentlich? Plötzlich fällt uns auf, dass die ganzen städtischen Gesundheitsämter eine wichtige Bedeutung für uns haben. Uns fällt auf, dass die Grundausstattung von Krankenhäusern mit Krankenhausbetten, mit Intensivbetten, mit gut ausgebildetem Personal – egal ob das Ärzte oder Pflegerinnen und Pfleger sind – dass all das eine Bedeutung hat, die wir vorher nicht gesehen haben. Wir fragen uns plötzlich, warum es die letzten zwanzig Jahre so wenig Forschung gegeben hat, was mögliche Impfstoffe gegen diese Viren angeht, und die Antwort ist relativ einfach: Damit lässt sich eben kein Geld verdienen im Vergleich zu anderen pharmazeutischen Produkten. Diese ganzen Überlegungen darüber, was wir eigentlich für ein Gesundheitssystem für unsere Gesellschaft wollen, sind glaube ich wichtig, und ich wünsche mir, dass wir dort eine Diskussion haben, in der es nicht allein um Effizienz und Kosten und Privatisierung geht.
Ihre Hoffnung für die Zeit nach Corona ist, dass wir uns ein Stück weit verabschieden vom schlanken Staat und vom effizienten Staat?
Wenn es um bestimmte Fragen geht, hat niemand was gegen Effizienz, aber es gibt eben viele Dinge, die sind nur unzureichend erfasst, wenn man fragt, ob sie jetzt effizient funktionieren oder nicht. Was ist eine effiziente Stadtbibliothek? Was ist ein effizienter Kindergarten? Was ist eine effiziente Grundschule? Was ist eine effiziente Universität? All diese Orte sind Orte, die eigentlich davon leben, dass sie ineffizient sind, weil sie Irritation produzieren, weil sie Dinge verlangsamen. Weil sie uns darüber stolpern lassen, dass wir vielleicht irgendetwas noch nicht bedacht haben.
Das heißt, wenn die Corona-Pandemie vorbei ist – wann auch immer das sein wird –, werden wir unsere Wertvorstellungen angepasst haben: Weniger auf Effizienz gucken, oder nur da, wo es notwendig ist, und mehr auf die Gemeinschaft, auf das Gemeinsame gucken und das auch pflegen, gemeinsam – hoffentlich. So verstehe ich Sie jetzt.
Mir kommt es nicht so sehr darauf an, bestimmte Werte in den Vordergrund zu rücken, weil sich gerade über Werte vortrefflich streiten lässt. Selbst wenn wir so vermeintlich selbstverständliche Dinge benennen wie Freiheit oder Gleichheit, ist am Ende einer langen Diskussion gar nicht mehr so genau klar, was damit gemeint ist, beziehungsweise gibt es viele verschiedene und nicht unbedingt auch noch vermittelbare Vorstellungen davon, was sich mit diesen Werten verbindet.
Aber ich glaube, was wir dringend brauchen, sind diese Räume, Orte, Plätze, an denen wir uns begegnen können, an denen wir uns streiten können und auf eine Weise streiten können, die nicht umschlägt in den Hass. Bei Edmund Burke heißt das »regulierte Aversion«, wo gleichsam die wechselseitige Abneigung eingehegt und eingezäunt ist. Es geht nicht darum, dass wir uns in den öffentlichen Räumen einigen auf irgendetwas, aber dass wir lernen miteinander so zu streiten, dass wir in der Zwietracht einen Gewinn sehen, der uns das demokratische Zusammenleben überhaupt erst ermöglicht. Weil die Demokratie eben immer nur vorübergehend Antworten auf Fragen formulieren kann. Und das gilt im Übrigen dann praktisch jetzt auch für die politischen Entscheidungen der nächsten Wochen und Monate. Und wichtig wäre mir dann nur, noch mal im Auge zu behalten: Alle diese Entscheidungen sollten Entscheidungen sein, die mit dem Geist der Demokratie vereinbar sind oder ihn sogar stärken.
Das war unser History and Politics Podcast über Mündigkeit und Demokratie in Zeiten der Krise mit Till van Rahden. Sein Buch »Demokratie – eine gefährdete Lebensform« ist im Buchhandel erhältlich. Weitere Informationen über unsere Arbeit im Bereich Geschichte und Politik und natürlich auch alle weiteren Folgen unseres Podcasts finden Sie auf der Internetseite der Körber-Stiftung. Ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder reinhören würden, wenn wir fragen, wie die Geschichte die Gegenwart prägt.
Produktion dieser Folge: hauseins.fm

Geschichte ist Gegenwart! Der History & Politics Podcast der Körber-Stiftung
Warum Geschichte immer Gegenwart ist, besprechen wir mit unseren Gästen im History & Politics Podcast. Wir zeigen, wie uns die Geschichte hilft, die Gegenwart besser zu verstehen.
-
Is Globalization unstoppable? Insights from the Past#73 38 min. 12. Jun 2024
-
Moldau: Perspektiven eines zerrissenen Landes#66 35 min. 7. May 2024
-
The New Germany S03E06: Extremism: Defending Democracy in Past and Present#72 50 min. 9. Apr 2024
-
Über die Geschichte einer gewaltfreien Gesellschaft#71 45 min. 2. Apr 2024
-
The New Germany S03E05: Social Transformation: What is German?#70 53 min. 26. Mar 2024
-
The New Germany, S03E04: Made in Germany: Industry and Deindustrialisation#69 49 min. 12. Mar 2024
-
History in the Age of Disinformation#68 51 min. 5. Mar 2024
-
The New Germany, S03E03: Germany and the US: Cowboys and Keynesians#67 51 min. 27. Feb 2024
-
Distance and emotion: Ukrainian historians in war times#65 53 min. 20. Feb 2024
-
The New Germany, Season 3 - Episode 2: Germany and France: A Marriage on the Rocks#64 56 min. 13. Feb 2024
-
The New Germany, Season 3 - Episode 1: Crisis Chancellors#63 55 min. 30. Jan 2024
-
Technologien gegen das Vergessen#62 36 min. 27. Jan 2024
-
Amerika – das Ende eines Traums?#61 64 min. 12. Dec 2023
-
The New Germany, S02E07: Grenzen überwunden? Das Verhältnis zwischen Ost und West#60 84 min. 14. Nov 2023
-
Zwischen Moral und Realpolitik: Das deutsch-israelische Verhältnis#59 46 min. 12. Sep 2023
-
Chatting with the Past#58 47 min. 8. Aug 2023
-
Die Arktis – Von der Friedenszone zur internationalen Konfliktzone#57 37 min. 4. Jul 2023
-
Zeitenwende and the Return of History#56 44 min. 8. Jun 2023
-
Polen und Europa seit 1989#55 33 min. 30. May 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 6: German Politics in Flux#54 43 min. 9. May 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 5: German Schuldenangst#53 46 min. 25. Apr 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 4: Germany’s Grand Strategy#51 48 min. 11. Apr 2023
-
Politik unter Einsatz des Körpers#52 42 min. 6. Apr 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 3: Germany and Poland#49 47 min. 28. Mar 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 2: Germany and China#48 51 min. 14. Mar 2023
-
Das Jahr 1923 und German Schuldenangst#47 40 min. 7. Mar 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 1: Germany’s Russians#46 54 min. 28. Feb 2023
-
Rechte Geschichtsbilder im Video-Gaming#45 47 min. 15. Feb 2023
-
Asylpolitik: Eine Konfliktgeschichte#44 32 min. 12. Jan 2023
-
Aktivist:innen in Russland: Zwischen Untergrund und Friedensnobelpreis#43 35 min. 6. Dec 2022
-
Das Ringen um die neue Weltordnung#42 43 min. 21. Nov 2022
-
Ukraine: Eine Nation unter Beschuss#41 45 min. 21. Oct 2022
-
Wohnen – wo Privates politisch ist#40 32 min. 6. Sep 2022
-
The New Germany, Part 4: The Lid of History#39 52 min. 22. Aug 2022
-
The New Germany, Part 3: German Energy Policy and Russian Gas#38 43 min. 8. Aug 2022
-
The New Germany, Part 2: A Love-Hate Relationship#36 57 min. 25. Jul 2022
-
Russia: When History Becomes a Weapon (Englische Folge)#34 40 min. 19. Jul 2022
-
The New Germany, Part 1: The Bundeswehr and Germany's Mindset#35 42 min. 12. Jul 2022
-
Erinnerung hat Konfliktpotenzial – Wie sich unser Blick auf Geschichte ändert#33 48 min. 7. Jun 2022
-
Krieg in der Ukraine: ein historischer Wendepunkt?#32 35 min. 31. May 2022
-
Geschichte und Erinnerung in Games#31 28 min. 3. May 2022
-
Belarus: Was bleibt von den Protesten 2020?#30 30 min. 8. Mar 2022
-
Sind Russland und China heute Imperien?#29 39 min. 8. Feb 2022
-
#30PostSovietYears: Kann Kunst versöhnen?#28 39 min. 30. Nov 2021
-
China – Modernisierung zwischen Isolation und Öffnung#27 39 min. 28. Oct 2021
-
Deutschland und Polen - Geschichte und Zukunft einer guten Nachbarschaft#26 42 min. 23. Sep 2021
-
Russland - Großmacht mit historisch gewachsenem Sonderstatus?#25 33 min. 24. Jun 2021
-
Belarus – Über Proteste, Demokratie und Diaspora#24 39 min. 29. Apr 2021
-
Die Vorgeschichte der Hohenzollern-Debatte. Adel, Nationalsozialismus und Mythenbildung nach 1945.#23 54 min. 25. Mar 2021
-
Jüdisches Leben in Deutschland seit 1945#20 50 min. 25. Feb 2021
-
Deutschland und Frankreich – Fremde Freunde?#22 40 min. 27. Jan 2021
-
Geschichtsvermittlung ist eine Zukunftsbranche#21 27 min. 17. Dec 2020
-
Tatjana Tönsmeyer: Das europäische Erbe der NS-Besatzungsherrschaft#19 34 min. 26. Nov 2020
-
Natasha A. Kelly: Rassismus und die Geschichte Schwarzer Menschen in Deutschland#18 40 min. 19. Oct 2020
-
Sandra Günter: Sport macht Gesellschaft?#17 37 min. 24. Sep 2020
-
Stefanie Middendorf: Geschichte der Staatsverschuldung: Kredite für die öffentliche Hand#16 40 min. 27. Aug 2020
-
Helene von Bismarck: Großbritannien und die EU – ein historisches Missverständnis?#15 34 min. 27. Jul 2020
-
Aleida Assmann: Was hält Europas Sterne zusammen?#14 24 min. 25. Jun 2020
-
Birte Förster: Rolle rückwärts bei der Gleichberechtigung?#13 29 min. 8. Jun 2020
-
Till van Rahden: Demokratie in Krisenzeiten#12 30 min. 6. May 2020
-
Elke Gryglewski: Alles gesagt, alles gezeigt?#11 23 min. 17. Apr 2020
-
Frank Uekoetter: Pandemien und Politik#10 25 min. 27. Mar 2020
-
Mary Elise Sarotte: Die NATO-Osterweiterung.#9 29 min. 20. Nov 2019
-
Werner Plumpe: Die Kraft des Kapitalismus.#8 21 min. 23. Oct 2019
-
Ilko-Sascha Kowalczuk: 30 Jahre Mauerfall – und nun?#7 23 min. 1. Oct 2019
-
Claudia Weber: Kriegsausbruch 1939#6 24 min. 11. Jul 2019
-
Jason Stanley: Faschismus damals und heute#5 18 min. 4. Jul 2019
-
Philip Murphy: Rule Britannia?#4 24 min. 27. Jun 2019
-
Hedwig Richter: Volksbegehren oder Staatsgewalt?#3 22 min. 20. Jun 2019
-
David Ranan: Israelkritik und Antisemitismus#2 22 min. 13. Jun 2019
-
Eckart Conze: Von Versailles 1919 zu den „Neuen Kriegen“#1 28 min. 28. May 2019