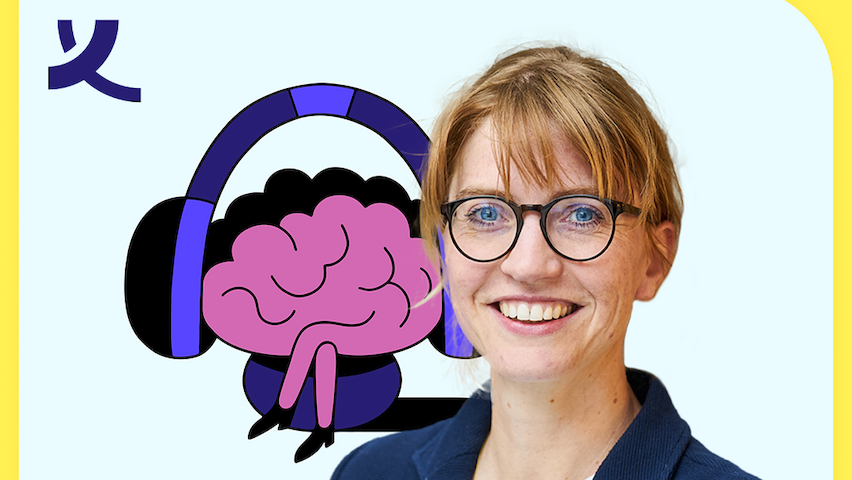Helene von Bismarck: Großbritannien und die EU – ein historisches Missverständnis?
Geschichte ist Gegenwart! Der History & Politics Podcast der Körber-Stiftung
Geschichtspolitik und Geschichtsbilder rund um den Brexit
Wie „anders“ ist Großbritannien im Vergleich zu Kontinentaleuropa? Welches Geschichtsverständnis steht hinter dem Konzept des „Global Britain“, das die Diskussionen rund um den Brexit bis heute prägt? Und was sagen historische Vorbilder über das Selbstverständnis aktueller britischer Politikerinnen und Politiker aus? Darüber spricht die Historikerin und Großbritannien-Kennerin Helene von Bismarck im neuen History & Politics Podcast
https://www.koerber-stiftung.de/koerber-history-forum https://twitter.com/koerbergp https://www.facebook.com/KoerberStiftung/
„Was meiner Ansicht nach ein großes Problem ist […], ist, wenn man argumentiert, es gäbe überhaupt keine Wahrheit mehr, es gäbe nur noch Meinung. Das ist insgesamt auch ein bisschen die Zeit, in der wir leben. Das sehen wir zunehmend nicht nur in Großbritannien, dass alles relativiert wird, dass wir alle so mit Informationen überflutet werden, sodass wir uns auch leicht die rauspicken können, die uns am besten ins Weltbild passen. Und dass diese Informationsüberflutung und dieser allgemein verbreitete Zynismus und Relativismus auch instrumentalisiert wird, gerade von populistischen Politikern.“
Helene von Bismarck, Historikerin und Großbritannien-Kennerin
Hallo und herzlich willkommen! Dies ist eine neue Folge von History and Politics, dem Podcast der Körber-Stiftung zu Geschichte und Politik. Wie jedes Mal sprechen wir auch heute mit einem Gast über ein aktuelles politisches oder gesellschaftliches Thema. Und fragen, wie uns die Vergangenheit dabei helfen kann, die Gegenwart besser zu verstehen. Ich bin Gabriele Woidelko und freue mich, dass Sie bei uns reinhören.
In dieser Folge geht es darum, welche Bedeutung unterschiedliche Interpretationen der Geschichte beim Brexit und für das Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU hatten und haben. Welches Geschichtsverständnis steht hinter dem Konzept des »Global Britain«, des weltoffenen Großbritannien, das die Diskussionen rund um Brexit und Freihandel bis heute prägt? Wo gibt es Missverständnisse zwischen Kontinentaleuropa und dem Vereinigten Königreich und wie lassen sie sich historisch einordnen? Und was hat es mit Winston Churchill und Franklin D. Roosevelt als historischen Vorbildern von Premierminister Johnson und anderen Befürworterinnen und Befürwortern des Brexit auf sich?
Darüber habe ich mit der Historikerin Helen von Bismarck gesprochen, die seit vielen Jahren über die Rolle Großbritanniens in den internationalen Beziehungen und über das Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU forscht, schreibt und diskutiert.
Helene von Bismarck, als Expertin, als Historikerin, sind Sie sehr lange schon mit Großbritannien vertraut. Sie haben sich lange mit diesem Land beschäftigt. Sind Sie seit 2016 manchmal verzweifelt an Ihrer Leidenschaft für Großbritannien?
Helene von Bismarck:
Ja, schon. Die schwerste Frage, gleich am Anfang! Es ist schon traurig, gar nicht nur unbedingt als Deutsche, sondern insgesamt als Nicht-Britin. Wenn man eine große Passion für dieses Land hat und sich beruflich damit den ganzen Tag beschäftigt, ist es schon zum Teil traurig zu sehen, welche Ausmaße die Debatte über den Brexit und dabei auch die Debatte über Europa, die in Großbritannien geführt wird, angenommen hat. Und es ist auch dann, wie ich finde, wahnsinnig wichtig, die eigene Nationalität zu vergessen und sich einfach dieser Diskussion zu stellen und zu versuchen, sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen. Egal, was für Gefühle das vielleicht in einem auslöst. Umgekehrt ist es aber leider auch so, dass es einem leicht passieren kann, dass einem gesagt wird, als Deutsche verstünde man das sowieso nicht oder als Europäerin sei man sowieso voreingenommen oder würde einfach blind die EU verteidigen und den britischen Standpunkt nicht verstehen. Also es ist traurig, zu sehen – und das ist ja nicht nur bei diesem Thema so, das ist ja insgesamt so, wenn man sich mit Politik beschäftigt –, wenn einem unterstellt wird, man könne nicht mehr objektiv oder analytisch arbeiten, aufgrund der Herkunft oder der sonstigen Interessen.
Das heißt, die aktuelle Debatte befeuert aus Ihrer Sicht eben auch die Vorurteile oder führt zu einem Wiederaufleben von Stereotypen?
Sagen wir mal so, die Stereotypen werden ganz massiv eingesetzt in der öffentlichen Debatte. Und ich glaube, das wichtigste oder einflussreichste Klischee in dieser Debatte ist die Idee des britischen Exzeptionalismus, dass also Großbritannien einfach grundsätzlich anders sei – im Wesen anders sei – als der Rest von Europa und dass auch die britische Geschichte sich fundamental von der kontinental-europäischen unterscheide. Und auf dieser Klischee-Vorstellung von britischer Geschichte wird dann das Argument aufgebaut, dass Großbritannien einfach nie in die EU gepasst habe, dass also die gesamte britische Mitgliedschaft, die ja nun Jahrzehnte überdauert hat, von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen sei. Und damit wird der Brexit überhöht, letztlich als logische Folge eines Prozesses, der in dem Moment, wo Großbritannien der damaligen Europäischen Gemeinschaft beigetreten ist, schon angefangen hat.
Geschichte ist ein gutes Stichwort. Geschichte und Politik gehen in Großbritannien, auch in anderen Ländern, eng zusammen. Großbritannien ist von der Corona-Pandemie hart getroffen und jetzt hat kürzlich Premierminister Johnson eine Roosevelt-Strategie angekündigt für die Überwindung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Mich würde interessieren: Was meint er damit? Und was sagt das über sein Geschichtsbild aus?
Ja, also das ist ganz faszinierend, weil Boris Johnson schon immer dazu tendierte, sich Heldenvorbilder in der Geschichte zu suchen und dann als Politiker anzukündigen, dass er vorhat, sie zu imitieren. Bis vor genau zwei Tagen, wir sprechen hier am ersten Juli, war das immer Churchill. Jetzt ist es auf einmal Franklin Roosevelt und die Idee dabei ist, glaube ich – und es ist wirklich nicht sehr ausgefeilt bis jetzt, wer weiß, was noch kommt –, den amerikanischen Präsidenten zu imitieren, der mit einer radikalen, oder für damalige Maßstäbe radikalen, Politik die Ärmsten im Land, die sozial Schwachen, unterstützt hat. Und Johnson hat jetzt also auf einmal angekündigt, er sei ein »Rooseveltianer« – was das nun im Einzelnen heißt, bleibt abzusehen. Es ist letztendlich sicher die Ankündigung für eine Haltung, die eigentlich untypisch ist für die Konservative Partei, nämlich die Haltung, möglicherweise Steuern zu erhöhen, öffentliche Ausgaben drastisch zu erhöhen, was in Teilen seiner Partei wahrscheinlich nicht unbedingt gut ankommt.
Was bedeutet das, dieser Wechsel zwischen den beiden Vorbildern?
Also ich würde sagen, es ist gar nicht so, dass jetzt Roosevelt Churchill abgelöst hat – überhaupt nicht, sondern dass Johnson letztlich diese großen historischen Figuren benutzt als Bausteine für seine politische Rhetorik. Er möchte eigentlich beides gleichzeitig sein. Das ist insofern interessant, weil Johnson und auch sein gesamtes Kabinett die Leute sind, die 2016 die Leave-Kampagne angeführt haben. Während des Brexit-Referendums und seit letztem Herbst sind sie nun tatsächlich an der Spitze der Macht in Großbritannien angekommen. Und sie haben letztlich zwei große Projekte: Das eine ist die Idee von einem Global Britain, das bezieht sich sehr auf die Außenpolitik und da geht es darum, ein weltoffenes Land zu sein, das seine alten, historischen Verbindungen zu großen Teilen der Welt wieder aufleben lässt, den Freihandel vorantreibt und gleichzeitig weit über das kleine, provinzielle Europa hinausschaut. Und für dieses Global Britain ist Churchill die Gallionsfigur. Der Mann, der Großbritannien alleine gegen den Rest der Welt 1940 gegen die Nazis verteidigt hat. Diese neue Idee mit Roosevelt, die bezieht sich auf das andere große Projekt, was es auch schon länger gibt – bis jetzt wurde nur dieses Vorbild nicht genannt: Das ist Levelling Up und bedeutet letztendlich, die soziale Ungleichheit zu reduzieren im ganzen Land und sich gerade auch die Regionen, wo es mit der Infrastruktur zum Beispiel sehr hapert, gerade im Norden des Landes, zu stärken. Also ich sehe das so: Für die verschiedenen Regierungsprojekte wird sich eine passende – ob die tatsächlich passt, ist dann nochmal eine ganz andere Frage – historische Figur rausgesucht und die wird dann instrumentalisiert.
Was bedeutet denn dieses Vorgehen eigentlich für das Geschichtsbild dieser Politiker, die derzeit im Amt sind? Welche Art von Geschichtsbild zeigt uns das?
Boris Johnson hat selbst ein Buch über Churchill geschrieben, eine Biographie, und da ist schon allein der Titel spannend: »The Churchill Factor. How One Man Made History«. Das ist ganz klar die Idee von »Great men make great history«, also eine absolute Individualisierung der Geschichte. Und wenn man sich dieses Buch durchliest, ist es spannend, denn letztendlich hat man das Gefühl, dass Boris Johnson, der damals der Bürgermeister von London war, ein aufstrebender Politiker, sich diesen Mann anschaut und ganz offen fragt: Wie hat er das geschafft? Wie hat er es geschafft, so viel zu erreichen, so mächtig zu sein, so kreativ zu sein, die Nazis zu bekämpfen, Bilder zu malen, seine Depressionen zu überwinden? Wo kam diese Kraft her? Darum geht es ihm in dem Buch, das ist der analytische Faden. Das spricht ehrlich gesagt für einen gewissen Narzissmus, weil die Geschichte, die als Untersuchungsgegenstand dient, letztendlich dazu einlädt, eine Anleitung zu finden, wie man selbst als Politiker erfolgreich sein kann. Und wenn wir jetzt auf Roosevelt kommen: Wie gesagt, das ist meiner Ansicht nach noch nicht sehr ausgefeilt, diese ganze Idee. Trotzdem ist es erstens wieder ein großes, berühmtes Schlagwort. Zweitens ist es die Idee mit Roosevelt – dieses Bild des mildtätigen, großen Präsidenten – in gewisser Hinsicht eine Anbiederung an die Amerikaner und es ist auch der Versuch, dieses Image der Tory-Partei als nasty party, als der Partei, die mit den sozial Schwächeren nicht sehr freundlich umgeht, zu verändern.
Wenn sie davon sprechen, dass Boris Johnson sich einzelne Figuren herausnimmt, und sie als Vorbilder stilisiert, wenn auf Churchill fokussiert wird, als dem Mann, der alleine Großbritannien verteidigt hat, wenn es um Roosevelt geht, der dieses wirtschaftliche Wiederaufbauprogramm für die Ärmsten der Armen mitinitiiert hat, dann werden ja bestimmte andere Aspekte der historischen Persönlichkeit wissentlich ausgeblendet. Inwieweit finden Sie das problematisch mit Blick auf eine demokratische Debatte über Geschichte?
Sagen wir mal so: Ich habe absolut nichts dagegen, wenn man Vorbilder hat. Was ich problematisch finde, ist, wenn man die Geschichte unterteilt, historische Figuren unterteilt, in Gruppen von Helden und Gruppen von Bösewichten. Es ist grundsätzlich gar nichts dagegen zu sagen, dass man Vorbilder hat als Politiker. Natürlich nicht und ich bin auch sehr dafür, dass sich Politiker viel mit Geschichte auseinandersetzen. Was meiner Ansicht nach problematisch ist, ist, wenn man immer auf der Suche ist nach der Bestätigung der eigenen Wertvorstellung. Da gibt es auch noch ein anderes Beispiel: Jacob Rees-Mogg ist auch Mitglied von Johnsons Kabinett und einer der absoluten Hardliner, was den Brexit anbetrifft. Der hat 2019 ein historisches Buch veröffentlicht. Auch da ist der Titel wieder interessant. Das heißt »The Victorians. Twelve Titans who Forged Britain«, zwölf Titanen, die Großbritannien geschmiedet haben. Und das zeigt ja schon wieder dieses Geschichtsbild. Es gibt zwölf Aufsätze über Persönlichkeiten, eine davon ist eine Frau, das ist Queen Victoria, alle anderen sind Männer. Diese großen Männer haben also das Land zu dem gemacht, was es ist. Rees-Mogg sagt ganz offen in seiner Einleitung, dass es ihm darum geht, die Wertvorstellung der viktorianischen Zeit wiederaufleben zu lassen, dass dies Menschen gewesen seien, die einfach eine moralische Vision gehabt hätten. Die hätten ein Pflichtbewusstsein gehabt und die hätten eine Energie gehabt. All das sei ja heutzutage aus der Mode, aber – und das sagte auch ganz explizit: Großbritannien müsse sich, wenn es nicht überholt werden wolle, auf diese alten Werte zurückbesinnen und die wiedervereinnahmen, um seinen Platz in der Welt einzunehmen und voranzukommen. Das ist also diese Idee von der Schicksalshaftigkeit der Geschichte. Das hat also mit Analyse der Vergangenheit nicht mehr viel zu tun, sondern da wird letztlich nach Moral und politischen Argumenten gesucht.
Wenn ich mir das so anhöre, könnte ich mir vorstellen, dass es doch eigentlich einen Aufstand der Historikerinnen und Historiker geben müsste, die sich eben genau dazu zu Wort melden und sagen: Eine analytische Auseinandersetzung mit Geschichte geht anders. Gibt es eine Debatte dazu?
Oh ja, das muss man auch sagen, das gibt es absolut. Also gerade Rees-Moggs Buch ist in einer Art und Weise verrissen worden, das war nicht mehr schön. Da haben Historiker und auch Journalisten, die politisch durchaus konservativ sind, gesagt, das sei ein derartig schlechtes Buch. Bis jetzt habe man den Gedanken, dass dieser Mann je Premierminister werden könnte, als lächerlich empfunden, aber wenn das bedeuten würde, dass er dann keine Bücher mehr schreibt, sollte man das vielleicht im Kauf nehmen. So brutal waren da die Rezensionen. Es ist auch tatsächlich einfach sehr schlecht geschrieben. Die Auswahl der Persönlichkeiten ist mehr als erstaunlich. Also wenn man die zwölf wichtigsten Briten benennt und dann Charles Dickens nicht erwähnt, kann man sich fragen, wie aussagekräftig das ist. Und bei Johnsons Buch über Churchill war es so, dass sich damals die meisten Journalisten drauf gestürzt haben, weil es ihnen einfach etwas über Johnson gesagt hat und nicht, weil sie was über Churchill lernen wollten. Es ist insgesamt auf jeden Fall so: Momentan ist Geschichte ein heißumkämpftes Thema, nicht nur in Großbritannien. Da haben wir jetzt auch mit der Black Lives Matter-Bewegung und mit der Diskussion um Repräsentation im öffentlichen Raum und Statuen und Denkmäler zu tun. Da prallen Welten aufeinander und da gibt es viele engagierte Historiker, die sich zu Wort melden. Wenn man aber so selektiv an die Geschichte rangeht, dass man sie letztendlich verzerrt – ob das bewusst geschieht oder einfach durch Ignoranz – ist das meiner Ansicht nach problematisch. Also, um ein Beispiel zu nennen im Kontext dieser ganzen Diskussion um die Denkmäler: Johnson hat neulich eine neue, außenpolitische Entscheidung im Parlament angekündigt und gesagt, mit dieser Entscheidung stehen wir in der großen Tradition des Landes, das den Sklavenhandel abgeschafft hat und die Welt gegen die Faschisten verteidigt hat. Das ist natürlich sehr selektiv, wenn man sagt, das ist die Essenz unserer Geschichte, das ist wer wir sind, das ist unsere Identität. Wir haben den Sklavenhandel beendet und wir haben die Nazis allein bekämpft. Und diese beiden Annahmen sind allein genommen gar nicht falsch, aber man kann nicht nur darüber sprechen, wie Großbritannien den Sklavenhandel beendet hat – man muss auch darüber sprechen, wie sich Großbritannien am Sklavenhandel beteiligt hat und wie man profitiert hat. Ich habe gar nichts dagegen, das eine zu betonen, aber das andere komplett wegzulassen, da entsteht meiner Ansicht nach ein Zerrbild der Geschichte. Und das empfinde ich als problematisch.
Man muss, wenn man über Großbritannien und den Sklavenhandel und den Kolonialismus spricht, eben auch darüber sprechen, dass sich Strukturen mangelnder Repräsentation bis heute in der britischen Gesellschaft durchziehen und dass diese Repräsentation jetzt, sie haben das Stichwort Black Lives Matter genannt, auch eingefordert wird. Also es ist nicht nur eine kritische Auseinandersetzung mit den historischen Vorbildern und ihren Schattenseiten. Da reden wir dann ja auch über ein großes gesellschaftliches Thema.
Auf jeden Fall und das tun wir auch nicht nur in Großbritannien, das passiert jetzt zum Beispiel auch in Belgien, in Frankreich, das passiert auch bei uns. Es ist auch wieder interessant zu sehen, wie gerade die britische Regierung – letztlich als Verlängerung der Vote Leave-Kampagne von 2016 – die britische imperiale Geschichte interpretiert. Ich bin immer ein Gegner gewesen von dem Argument, die Briten hätten für den Brexit gestimmt aus imperialer Nostalgie. Ich finde den Begriff der imperialen Amnesie sehr viel zutreffender. Was ich damit meine ist, dass in den Debattenbeiträgen und gerade in den Artikeln oder Reden, wo für den Brexit geworben wurde und für die heutige neue Außenpolitik geworben wird, das Empire kaum erwähnt wird. Was erwähnt wird, ist die »Free Trading History«. Die Briten werden dargestellt als die Seefahrer, die Abenteurer, die Unternehmer, die Erfinder, die weltoffenen Menschen, die einfach eine globale Perspektive entwickelt haben. Der Aspekt, dass all das entstanden ist im Kontext des Imperialismus und unter Gesichtspunkten wie Unterwerfung und Militarismus – all das wird ausgeblendet. Das Empire wird also gesehen als Ausdruck und Verlängerung von britischer Macht und Stärke und nicht als die Grundlage von britischer Macht und Stärke. Das ist eine so selektive Art, eine Geschichte anzusehen, das ist eine Verzerrung. Natürlich hat Großbritannien eine globale Geschichte. Das ist das, was mich mit am meisten fasziniert an diesem Land. Aber wenn man das so umdeutet, dann wird man meiner Ansicht nach dieser Geschichte nicht gerecht.
Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass im Rahmen der Brexit-Kampagne oder der Remain-Kampagne beide Seiten die Geschichte bemüht haben. Jetzt haben wir sehr lange über das Geschichtsbild von Boris Johnson und den sogenannten Brexiteers gesprochen. Es würde mich interessieren: Welche Geschichtsbilder denn die andere Seite, also diejenigen bemüht haben, die sich für einen Verbleib Großbritanniens in der EU aussprachen. Also haben die dann andere Aspekte dieses globalen Geschichtsbildes benutzt, das sie gerade angesprochen haben?
Grundsätzlich würde ich sagen, dass die Remain-Seite sehr viel weniger historische Beispiele bemüht hat als die Leave-Seite und auch grundsätzlich sehr viel weniger mit Fragen der Identität gearbeitet hat. Das lag auch insgesamt an der Art der Kampagne, die war – letztlich muss man es so sagen – ein bisschen zu entspannt. Ich glaube, da war die Grundannahme, dass die Briten sowieso für den Verbleib in der EU stimmen würden, zu stark und es wurde dann in erster Linie sich immer darauf konzentriert zu sagen, was der Brexit für einen wirtschaftlichen Schaden bedeuten würde. Es wurden sehr viel weniger kulturelle, identitätsstiftende oder historische Beispiele bemüht. Allerdings gibt es ein paar Ausnahmen. Eine Sache, die immer wieder kommt, ist das, was wir auch auf dem Kontinent immer wieder hören als Legitimation für die europäische Integration – dass es ein Friedensprojekt ist. Also da ist der Hinweis auf die Weltkriege und wie bedeutend es ist, dass wir auf diesem Kontinent seit so vielen Jahrzehnten keinen Krieg mehr haben. Zumindest auf Teilen des Kontinentes. Das wurde dann hervorgehoben. Was ganz interessant ist, ist tatsächlich wieder das Beispiel von Churchill: Der wurde nämlich von beiden Seiten vereinnahmt. Denn Churchill ist ja nicht nur berühmt für seine Haltung 1940, als Großbritannien allein stand – wobei auch da interessanterweise immer das Empire ausgeblendet wird –, sondern er ist auch der Mann, der die berühmte Rede von den United States of Europe gehalten hat. Der also plädiert hat für europäischen Zusammenhalt und europäische Integration und der sich dafür engagiert hat nach dem Krieg. Was unklarer ist, ist wie er die britische Rolle in dieser europäischen Integration gesehen hat. Das muss man fairerweise sagen. Er hat einerseits sehr dafür plädiert, dass Europa näher zusammenrückt. Er hat aber auch gesagt, »we are with Europe, not of it«. Wir sind mit ihnen, es sind unsere Freunde, unsere Verbündeten, aber wir sind nicht Teil davon. Und da ist Churchill eben wirklich interessant: Dieser Mann hat ja nun so viel in seinem Leben erlebt, gemacht, geredet, geschrieben, dass er wie eine Fundgrube ist für verschiedene Leute, mit verschiedenen politischen Ansichten, die sich dann das raussuchen, was ihnen am genehmsten ist.
Geschichte als Werkzeugkasten, wo man sich das Werkzeug rausholt, was gerade passt. Der Zweite Weltkrieg ist ja schon ein Kernthema, ein Kern, um den die britische Identität auch ein Stück weit kreist. Es gibt mit Blick auf die britisch-deutschen Beziehungen, dieses Sprichwort »Don't Mention The War«. Meine Frage wäre: Why do we need to mention the war? Warum ist es doch nochmal sinnvoll, über den Zweiten Weltkrieg zu sprechen? Ist es sinnvoll, über den Zweiten Weltkrieg zu sprechen, wenn wir verstehen wollen, wie speziell Deutschland und Großbritannien sich zueinander verhalten?
Ich denke, dass es sehr wichtig ist. Das wäre auch ein Rat für mich an deutsche Politiker: Wenn man denkt, es bringt nichts zu sagen oder ich finde es nervig, dass die immer weiter über den Zweiten Weltkrieg reden; wenn man nicht begreift, wie tief das geht und wie einfach sich das auch in Großbritannien politisch instrumentalisieren lässt – und momentan wird es ganz massiv in den Vordergrund geschoben, von der vordersten Reihe der Politik –, dann begreift man britische Politik nicht. Das ist sozusagen etwas, da muss man mit arbeiten. Das kann man nicht einfach als Humbug ignorieren. Das ist insgesamt ein Thema in dieser ganzen Brexit-Diskussion: Dass man vielleicht die Argumente absurd finden mag. Man muss sich aber nicht nur mit den Argumenten inhaltlich auseinandersetzen, sondern man muss sich damit auseinandersetzen, wie sie so erfolgreich werden konnten, wie sie so sich so verbreiten konnten und wie man möglicherweise den eigenen Standpunkt rüberbringen kann in einer so gewachsenen Debatte. In Großbritannien ist es natürlich wichtig, über den Zweiten Weltkrieg zu reden. Da ist eben das Problem, das wird von vielen Historikern kritisiert, dass eben dieses standing alone so betont wird und letztendlich die Hilfe, die Großbritannien aus dem Empire und Commonwealth zuteil wurde, dass die ausgeblendet wird. Das ist tatsächlich auch eine selektive Herangehensweise. Ich glaube, der Zweite Weltkrieg ist insofern wichtig, weil er von allen exzeptionalistischen Argumenten über die britische Geschichte das Einzige ist, was mich ansatzweise überzeugt. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass Großbritannien nie besetzt worden ist. Und dass die politischen Strukturen nicht, wie fast überall sonst in Europa, komplett zerschlagen worden sind, dass es keine Vertreibung gab. Diese Erfahrung von Vertreibung und Besetzung, von Terrorherrschaft durch die Nazis – das ist eine universaleuropäische Erfahrung Und das ist eine Erfahrung, die die Briten bis auf winzige Inseln nicht haben. Und deswegen ist es nicht so erstaunlich, dass diese ganze Idee von Europa als Friedensprojekt in Großbritannien vielleicht weniger Erfolg hat als in den Niederlanden oder eben auch in Deutschland.
Haben Sie das Gefühl, dass dieses Verständnis für die herausgenommene Rolle Großbritanniens im Zweiten Weltkrieg in der Politik in Deutschland oder auch in der EU schon genug angekommen ist?
Na ja, ich habe schon den Eindruck, dass in den letzten Jahren oder gerade seit dem Brexit da eine etwas bequeme Tendenz besteht, tatsächlich diese exzeptionalistischen Argumente zu sehr zu übernehmen. Ich habe auch schon Leute sagen hören: »Die Briten haben immer Ärger in der EU gemacht, ist es vielleicht wirklich einfacher ohne sie?« Dieses Argument, wonach die Briten einfach anders sind als wir, dort auf ihrer Insel, das ist eins, das man sehr oft hört. Es ist schön, wenn man sich mit Eigenheiten auseinandersetzt. Es ist aber bequem, wenn man es in den Ordner abheftet: »Die sind sowieso anders und die spinnen sowieso und deswegen müssen wir uns damit jetzt nicht beschäftigen.« Das ist letztendlich auch die Idee: »Die haben für den Brexit gestimmt, die Konsequenzen sind ihr Problem und fertig.« Es ist natürlich richtig, dass sie dafür gestimmt haben. Und ich bin absolut dafür, dass die Deutschen und insgesamt die anderen Mitglieder der EU jetzt ihre Interessen verteidigen und das tun, was für Europa am besten ist. Trotzdem halte ich es für sinnvoll, sich mit dieser Diskussionskultur und auch mit der zunehmenden Spaltung, die da in der britischen Gesellschaft besteht, auseinanderzusetzen. Denn Großbritannien bleibt ein wichtiger wirtschaftlicher und gerade auch sicherheitspolitischer Partner für Deutschland, für viele europäische Länder. Die schwimmen ja nicht weg! Wir müssen ja trotzdem in Zukunft miteinander klarkommen. Ich denke – das ist meine persönliche Meinung –, es gibt Unterschiede zwischen der britischen Geschichte und der vieler anderer EU-Mitgliedsstaaten. Diese Unterschiede sind wichtig. Dass ihre logische Konsequenz wäre, dass Großbritannien kein Teil der EU sein kann: absolut nicht. Und das ist ein Argument, das wird jetzt gerne von dem Brexiteers in der ersten Reihe betont und das ist eins, das – zum Teil auch aus Frustration, über die letzten vier Jahre – gerne auf europäischer Seite übernommen wird, aber da schließe ich mich nicht an.
Wir haben jetzt sehr viel schon gehört über den Zweiten Weltkrieg und warum er doch ein Kernpunkt ist der Fragen, um die britische Identität heute kreist. Mich würde mit Blick auf die deutsch-britischen Beziehungen interessieren, wie Sie das historische Deutschlandbild der amtierenden, britischen Politiker und Politikerinnen einordnen würden.
Das ist ganz spannend, weil es voller Widersprüche ist. Wenn heutzutage die britische Regierung betont, sie möchte sehr enge Beziehungen, bilaterale Beziehungen, zu Deutschland haben, dann ist das ernst gemeint. Gleichzeitig ist es aber so, dass zum Teil von denselben Leuten in der Brexit-Kampagne und auch danach Vergleiche gemacht worden sind, die wirklich tief blicken lassen über die Wahrnehmung von Deutschland und auch wie tief dieses Thema des Zweiten Weltkriegs nach wie vor sitzt. Ganz vorne weg der jetzige Premierminister, der die europäische Integration als Projekt mit den Projekten Adolf Hitlers verglichen hat, ganz explizit. Diese Idee, dass die europäische Integration nur eine Fortsetzung des Nationalsozialismus mit friedlichen Mitteln sei und dass man sozusagen durch wirtschaftliche Kontrolle versucht zu erreichen, was die Nazis auf militärische Art versucht hätten zu erreichen. Das ist tatsächlich ein Argument, was man vor zehn Jahren nur an den Rändern hörte. Jeremy Hunt, momentan nicht mehr im Kabinett, hat letztes Jahr die EU mit der Sowjetunion verglichen, mit einem totalitären Regime, das muss man sich mal vorstellen. Erst jüngst hat der Vorsitzende der European Research Group, das ist eine Gruppe innerhalb der konservativen Partei, die auch absolute Hardliner sind, was den Brexit angeht, einen Brief geschrieben, an Michel Barnier, den Brexit-Chefverhandler der EU-Kommission und ihm darin wirklich geschrieben: »Alles, was wir wollen, ist ein freies Land zu sein, das seine eigenen Gesetze macht und wir werden uns von diesem Projekt nicht abbringen lassen.« Also die Implikation ist letztendlich, jedes EU-Mitglied sei kein freies Land. Also diplomatisch ist das nicht. Das stammt übrigens von dem gleichen Mann, der vor einiger Zeit berühmt oder berüchtigt wurde, weil er einen Brief von einem deutschen Unternehmer im Fernsehen zerrissen hat, der auf die Nachteile des Brexits hingewiesen hatte. Dieser Politiker, Marc Francois, hat daraufhin gesagt: »Mein Vater war im Zweiten Weltkrieg und der hat sich von den Deutschen nichts sagen lassen und ich lasse mir von den Deutschen auch nichts sagen.« Gut, das ist jetzt extrem, aber solche Gedanken sind durchaus vorhanden.
Ich höre da auch ein großes Selbstbewusstsein, einen großen Stolz auf eine lange demokratische Tradition. Wie passt diese demokratische, lange Tradition zu dem selektiven Umgang mit Geschichte? Das bekomme ich noch nicht zusammen.
Ja, man hört da nicht nur großen Nationalstolz heraus, man hört da auch eine absolute Ignoranz gegenüber der Geschichte der europäischen Integration heraus. Ein Unwissen darüber, wie die EU überhaupt funktioniert. Und große Vorurteile gegenüber Deutschland, das muss man auch festhalten. Das eine ist der positive Teil, der andere Teil ist, glaube ich, durchaus ebenfalls wichtig. Zwei Historiker, die sich mit demselben Untersuchungsgegenstand beschäftigen, werden immer andere Schwerpunkte setzen und andere Interpretationen finden. Was meiner Ansicht nach ein großes Problem ist – und da bin ich ganz bei Hannah Arendt –, ist, wenn man argumentiert, es gäbe überhaupt keine Wahrheit mehr, es gäbe nur noch Meinung. Das ist insgesamt auch ein bisschen die Zeit, in der wir leben. Das sehen wir zunehmend nicht nur in Großbritannien, dass alles relativiert wird, dass wir alle so mit Informationen überflutet werden, sodass wir uns auch leicht die rauspicken können, die uns am besten ins Weltbild passen. Und dass diese Informationsüberflutung und dieser allgemein verbreitete Zynismus und Relativismus auch instrumentalisiert wird, gerade von populistischen Politikern.
Was machen wir denn damit? Also, wie gehen wir damit um? Wenn ich »wir« sage, meine ich: Wir als Gesellschaft oder auch als Berufsgruppe, als Historikerinnen als Historiker. Welche Möglichkeiten haben wir?
Wir müssen einfach damit klarkommen in einer Demokratie, dass Streit gut ist, dass Uneinigkeit gut ist, solange respektvoll miteinander umgegangen wird. Wir dürfen keine Angst davor haben, dass die Welt sehr kompliziert und schwierig ist und die Vergangenheit eben auch.
Wie können wir denn in Zeiten des Austritts von Großbritannien aus der EU unterschiedlichen Erfahrungen eventuell produktiv nutzen? Wie können wir es hinkriegen, in ein produktives Miteinander zu kommen?
Ich finde das eigentlich sehr ermutigend, dass wir jetzt in so vielen Ländern uns streiten und diskutieren über die Geschichte der Kolonialzeit, über die Geschichte des Imperialismus, über Rassismus, der in unseren Gesellschaften leider nach wie vor besteht. Das ist durchaus etwas, was ich sehr positiv sehe, solange eben sachlich und respektvoll miteinander umgegangen wird in dieser Diskussion. Was jetzt den Brexit und Großbritannien betrifft: Ich veröffentliche ja sehr viel in England, in britischen Zeitungen oder auch sonstigen Medien und merke, dass mir fast jedes Mal gesagt wird, »wir finden es toll mal jemanden zu haben, der nicht hier aus Großbritannien kommt.« Das wird mir jetzt gesagt, aber am Anfang musste ich mich erstmal trauen. Ja, also man sollte sich nicht davor scheuen, auch wenn es Leute gibt, die einen dafür angreifen werden, als Ausländerin oder als Fremde sich in diesen Debatten zu Wort zu melden. Und ich glaube, wir brauchen davon auch sonst in Europa viel mehr. Wir brauchen eine europäische Öffentlichkeit. Gerade jetzt zum Beispiel mit der Ratspräsidentschaft ist das internationale Interesse an Deutschlands Haltung zu Europa sehr groß. Dann sollte man das aber nicht nur in Artikeln formulieren, die letztlich nur für die deutsche Öffentlichkeit gedacht sind.
Das war unser History and Politics Podcast mit Helene von Bismarck über die Bedeutung von Geschichtsinterpretationen und historischen Vorbildern in der aktuellen Politik Großbritanniens und in den europäisch-britischen Beziehungen. Wenn Sie mehr erfahren wollen über die Arbeit von Helene von Bismarck oder über aktuelle Debatten rund um Großbritannien und die EU, lohnt sich ein Blick auf ihren sehr aktiven Twitter-Account.
Weitere Informationen zur Arbeit des Bereich Geschichte und Politik der Körber-Stiftung finden Sie auf unserer Stiftungswebsite. Dort gibt es auch alle weiteren Folgen unseres History and Politics Podcasts.
Das war´s für heute, ich danke Ihnen für´s Zuhören und hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn wir fragen, wie die Geschichte unsere Gegenwart prägt.

Geschichte ist Gegenwart! Der History & Politics Podcast der Körber-Stiftung
Warum Geschichte immer Gegenwart ist, besprechen wir mit unseren Gästen im History & Politics Podcast. Wir zeigen, wie uns die Geschichte hilft, die Gegenwart besser zu verstehen.
-
Is Globalization unstoppable? Insights from the Past#73 38 min. 12. Jun 2024
-
Moldau: Perspektiven eines zerrissenen Landes#66 35 min. 7. May 2024
-
The New Germany S03E06: Extremism: Defending Democracy in Past and Present#72 50 min. 9. Apr 2024
-
Über die Geschichte einer gewaltfreien Gesellschaft#71 45 min. 2. Apr 2024
-
The New Germany S03E05: Social Transformation: What is German?#70 53 min. 26. Mar 2024
-
The New Germany, S03E04: Made in Germany: Industry and Deindustrialisation#69 49 min. 12. Mar 2024
-
History in the Age of Disinformation#68 51 min. 5. Mar 2024
-
The New Germany, S03E03: Germany and the US: Cowboys and Keynesians#67 51 min. 27. Feb 2024
-
Distance and emotion: Ukrainian historians in war times#65 53 min. 20. Feb 2024
-
The New Germany, Season 3 - Episode 2: Germany and France: A Marriage on the Rocks#64 56 min. 13. Feb 2024
-
The New Germany, Season 3 - Episode 1: Crisis Chancellors#63 55 min. 30. Jan 2024
-
Technologien gegen das Vergessen#62 36 min. 27. Jan 2024
-
Amerika – das Ende eines Traums?#61 64 min. 12. Dec 2023
-
The New Germany, S02E07: Grenzen überwunden? Das Verhältnis zwischen Ost und West#60 84 min. 14. Nov 2023
-
Zwischen Moral und Realpolitik: Das deutsch-israelische Verhältnis#59 46 min. 12. Sep 2023
-
Chatting with the Past#58 47 min. 8. Aug 2023
-
Die Arktis – Von der Friedenszone zur internationalen Konfliktzone#57 37 min. 4. Jul 2023
-
Zeitenwende and the Return of History#56 44 min. 8. Jun 2023
-
Polen und Europa seit 1989#55 33 min. 30. May 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 6: German Politics in Flux#54 43 min. 9. May 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 5: German Schuldenangst#53 46 min. 25. Apr 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 4: Germany’s Grand Strategy#51 48 min. 11. Apr 2023
-
Politik unter Einsatz des Körpers#52 42 min. 6. Apr 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 3: Germany and Poland#49 47 min. 28. Mar 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 2: Germany and China#48 51 min. 14. Mar 2023
-
Das Jahr 1923 und German Schuldenangst#47 40 min. 7. Mar 2023
-
The New Germany, Season 2 - Episode 1: Germany’s Russians#46 54 min. 28. Feb 2023
-
Rechte Geschichtsbilder im Video-Gaming#45 47 min. 15. Feb 2023
-
Asylpolitik: Eine Konfliktgeschichte#44 32 min. 12. Jan 2023
-
Aktivist:innen in Russland: Zwischen Untergrund und Friedensnobelpreis#43 35 min. 6. Dec 2022
-
Das Ringen um die neue Weltordnung#42 43 min. 21. Nov 2022
-
Ukraine: Eine Nation unter Beschuss#41 45 min. 21. Oct 2022
-
Wohnen – wo Privates politisch ist#40 32 min. 6. Sep 2022
-
The New Germany, Part 4: The Lid of History#39 52 min. 22. Aug 2022
-
The New Germany, Part 3: German Energy Policy and Russian Gas#38 43 min. 8. Aug 2022
-
The New Germany, Part 2: A Love-Hate Relationship#36 57 min. 25. Jul 2022
-
Russia: When History Becomes a Weapon (Englische Folge)#34 40 min. 19. Jul 2022
-
The New Germany, Part 1: The Bundeswehr and Germany's Mindset#35 42 min. 12. Jul 2022
-
Erinnerung hat Konfliktpotenzial – Wie sich unser Blick auf Geschichte ändert#33 48 min. 7. Jun 2022
-
Krieg in der Ukraine: ein historischer Wendepunkt?#32 35 min. 31. May 2022
-
Geschichte und Erinnerung in Games#31 28 min. 3. May 2022
-
Belarus: Was bleibt von den Protesten 2020?#30 30 min. 8. Mar 2022
-
Sind Russland und China heute Imperien?#29 39 min. 8. Feb 2022
-
#30PostSovietYears: Kann Kunst versöhnen?#28 39 min. 30. Nov 2021
-
China – Modernisierung zwischen Isolation und Öffnung#27 39 min. 28. Oct 2021
-
Deutschland und Polen - Geschichte und Zukunft einer guten Nachbarschaft#26 42 min. 23. Sep 2021
-
Russland - Großmacht mit historisch gewachsenem Sonderstatus?#25 33 min. 24. Jun 2021
-
Belarus – Über Proteste, Demokratie und Diaspora#24 39 min. 29. Apr 2021
-
Die Vorgeschichte der Hohenzollern-Debatte. Adel, Nationalsozialismus und Mythenbildung nach 1945.#23 54 min. 25. Mar 2021
-
Jüdisches Leben in Deutschland seit 1945#20 50 min. 25. Feb 2021
-
Deutschland und Frankreich – Fremde Freunde?#22 40 min. 27. Jan 2021
-
Geschichtsvermittlung ist eine Zukunftsbranche#21 27 min. 17. Dec 2020
-
Tatjana Tönsmeyer: Das europäische Erbe der NS-Besatzungsherrschaft#19 34 min. 26. Nov 2020
-
Natasha A. Kelly: Rassismus und die Geschichte Schwarzer Menschen in Deutschland#18 40 min. 19. Oct 2020
-
Sandra Günter: Sport macht Gesellschaft?#17 37 min. 24. Sep 2020
-
Stefanie Middendorf: Geschichte der Staatsverschuldung: Kredite für die öffentliche Hand#16 40 min. 27. Aug 2020
-
Helene von Bismarck: Großbritannien und die EU – ein historisches Missverständnis?#15 34 min. 27. Jul 2020
-
Aleida Assmann: Was hält Europas Sterne zusammen?#14 24 min. 25. Jun 2020
-
Birte Förster: Rolle rückwärts bei der Gleichberechtigung?#13 29 min. 8. Jun 2020
-
Till van Rahden: Demokratie in Krisenzeiten#12 30 min. 6. May 2020
-
Elke Gryglewski: Alles gesagt, alles gezeigt?#11 23 min. 17. Apr 2020
-
Frank Uekoetter: Pandemien und Politik#10 25 min. 27. Mar 2020
-
Mary Elise Sarotte: Die NATO-Osterweiterung.#9 29 min. 20. Nov 2019
-
Werner Plumpe: Die Kraft des Kapitalismus.#8 21 min. 23. Oct 2019
-
Ilko-Sascha Kowalczuk: 30 Jahre Mauerfall – und nun?#7 23 min. 1. Oct 2019
-
Claudia Weber: Kriegsausbruch 1939#6 24 min. 11. Jul 2019
-
Jason Stanley: Faschismus damals und heute#5 18 min. 4. Jul 2019
-
Philip Murphy: Rule Britannia?#4 24 min. 27. Jun 2019
-
Hedwig Richter: Volksbegehren oder Staatsgewalt?#3 22 min. 20. Jun 2019
-
David Ranan: Israelkritik und Antisemitismus#2 22 min. 13. Jun 2019
-
Eckart Conze: Von Versailles 1919 zu den „Neuen Kriegen“#1 28 min. 28. May 2019